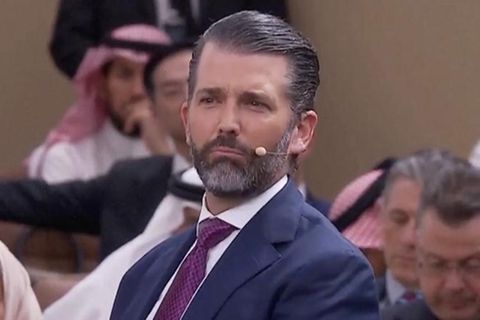In Deutschland sind an diesem Wochenende Hunderttausende bei Demos gegen rechts auf die Straße gegangen. Die jüngsten Entwicklungen rund um die AfD haben eine Protestwelle ausgelöst, wie es sie schon lange nicht mehr gab. Aber was ruft ausgerechnet jetzt die Menschen in Massen auf den Plan? Ein Gespräch mit dem psychologischen Psychotherapeuten Philipp Lioznov über die Psychologie der Massen und darüber, warum wir AfD-Wählern mit Empathie begegnen sollten.
Herr Lioznov, die Anti-AfD-Proteste haben in den letzten Tagen eine neue Dimension erreicht. Wie kommt es psychologisch betrachtet überhaupt zu Massenbewegungen?
Philipp Lioznov: Das ist multifaktoriell. Eine Ursache liegt sicher in der Bedürfnistheorie. Sie geht davon aus, dass wir verschiedene Grundbedürfnisse haben, die wir unbewusst befriedigen wollen. Das lenkt unser Handeln. Bei Demonstrationen wird zum Beispiel unser Grundbedürfnis nach Bindung bedient. Wenn wir sehen, dass hunderte Menschen für eine Sache auf die Straße gehen und uns ihnen anschließen, dann fühlen wir uns einer Gruppe zugehörig. Andersrum kann es auch sein, dass unser Grundbedürfnis nach Autonomie uns ins Tun bringt, weil wir uns von den aktuell regierenden Parteien nicht gesehen fühlen und wir durch den Protest das Gefühl der Selbstbestimmtheit zurückholen wollen. Als Drittes spielt bei manchen sicher auch die Selbstwerterhöhung eine Rolle. Wenn ich Teil einer Gruppe bin, dann steigert das auch meinen Selbstwert, weil ich vermeintlich stärker und mächtiger agieren kann als allein.
Könnten diese Bedürfnisse nicht auch dazu führen, dass man sich vom Rechtsruck mitreißen lässt?
Leider schon. Es kommt auch immer darauf an, welche Werte man verfolgt. Und darauf, welchen Leadern man sein Vertrauen schenkt. Populisten nutzen das Wissen aber tatsächlich gezielt, um ihre Anhänger zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung zu treiben.
Sie sprachen von mehreren Ursachen. Was bringt uns noch in die Massen?
Für mich als Traumatherapeut spielt vor allem unsere natürliche Reaktion auf eine Bedrohungslage in diesem Zusammenhang eine Rolle. Wenn Menschen sich angegriffen fühlen – in ihren Bedürfnissen oder ihrer Sicherheit –, dann reagieren sie entweder mit Flucht, Kampf oder Totstellen. Die Menschen, die wir dieser Tage auf der Straße sehen, sind in der Hinsicht eher Team Kampfreaktion.
Die Ruck nach Rechts und das Umfragehoch der AfD sind kein neues Thema. Auf den Straßen waren vorher aber nicht ansatzweise so viele Menschen. Was hat sich verändert?
Bei manchen Menschen ist das Maß glaube ich mittlerweile einfach voll. Wir alle haben nur begrenzte Kapazitäten, negative Nachrichten auszuhalten und drohende Veränderungen hinzunehmen. Und natürlich kann es auch ansteckend wirken, wenn plötzlich eine solche Bewegung entsteht und man es überall in den Medien sieht.

Wie genau wirken denn die Bilder der Anti-AfD-Proteste psychologisch auf uns?
Bilder lösen ganz unterschiedliche Emotionen in uns aus. Vor allem bei den Protesten kommt es auf die Grundeinstellung an. Wenn ich eher positiv gegenüber Protesten und dem Grund der Demo eingestellt bin, dann könnten die Bilder mich mitreißen und sogar motivieren, selbst auf die Straße zu gehen. Es kann auch sein, dass durch eine gewisse Empathie eine Art Perspektivübernahme einsetzt. Andersrum kann es natürlich auch wütend machen, wenn man politisch sehr anders tickt. Vor allem solche Großdemos lösen schnell mal Schwarz-Weiß-Denken aus. Also entweder ist man dafür oder dagegen, aber so einfach ist es nicht.
Also würden Sie sagen, die Demonstrationen können tatsächlich etwas bewirken?
Ich glaube, ja. Demonstrationen schaffen immer eine gewisse Awareness in der Gesellschaft. Allein die Tatsache, dass wir beide jetzt darüber sprechen, ist schon ein Gewinn für die Protestler. Denn darum geht es doch: Aufmerksamkeit für ein Thema, bei dem wir nicht mehr wegsehen sollten. Ich sehe gute Chancen dafür, dass die aktuelle Protestwelle auch manche der Menschen wieder ins Tun bringen kann, die sich längst in einer gewissen Lethargie vergraben haben. Dass Leute, die hoffnungslos geworden sind, also neuen Mut fassen, gegen rechts aufzustehen. Das Gleiche passiert allerdings aktuell auch auf der anderen Seite.
Inwiefern?
Man kann Menschen, die in diesen unsicheren Zeiten etwas verloren sind, in verschiedene Richtungen beeinflussen. Das heißt, die Psychologie der Massen kann auch gefährlich sein, wenn sie mit den falschen Motiven genutzt wird.
Wie funktioniert die Psychologie der Massen?
Die Theorie dazu stammt von dem Psychiater Gustave Le Bon. Er spricht von einem kollektiven Mindset, das entsteht, wenn man sich einer Gruppe anschließt. Und wir Menschen sind nun einmal Herdentiere. Das heißt, unsere Meinung und unser Verhalten wird unbewusst von der Gruppe beeinflusst, in der wir uns aufhalten, während unsere Individualität unterdrückt wird. Wir haben bei den Protesten also auf der einen Seite die Zugehörigkeit und auf der anderen Seite das Verschwimmen zu einer diversen Masse von Demonstranten, die alle für den gleichen Zweck kämpfen. Das kollektive Mindset ist aber auch prädestiniert dafür, dass Ideologien sich verbreiten. Hier ist es enorm wichtig, dass jeder Teilnehmer weiß, warum er Teil der Gruppe ist.
Die AfD hat in den vergangenen Monaten etliche Anhänger gewonnen. Was denken Sie, warum rechte Ideologien an Beliebtheit gewinnen?
Zum einen gab es in letzter Zeit sehr viele Krisen. Das löst bei vielen eine gewisse Unruhe aus, Ängste und Sorgen werden größer und die kulturellen und demographischen Veränderungen sorgen für eine grundlegende Unsicherheit. Wir Menschen können mit dem Gefühl einer so dauerhaften Instabilität nur schlecht umgehen, weil es gegen unser Grundbedürfnis nach Sicherheit spricht. Also entsteht irgendwann Frust, wir bauen Wut auf. Und genau dieses Gefühl wird von rechten Parteien aufgegriffen und genutzt. Aber auch das Thema Einsamkeit spielt sicher eine Rolle. Ich forsche dazu und stelle zunehmend fest, dass die wachsende Individualisierung unserer Gesellschaften bei manchen Menschen die Sehnsucht nach traditionellen Werten und konservativen Lebensmodellen steigert. Und die finden sie vor allem im Wahlprogramm von AfD und Co.
Wer mit der AfD sympathisiert muss also nicht automatisch auch rechtes Gedankengut haben. Nun bilden sich derzeit aber zwei Fronten: Pro-AfD und Anti-AfD. Wie können wir den Menschen begegnen, die sich am rechten Rand bewegen?
Mit Respekt, Empathie und Dialog. Bei den meisten dieser Menschen steht Angst im Vordergrund, deshalb rate ich gerne dazu, einen gewissen Empathievorschuss zu geben, zu versuchen, Verständnis aufzubringen, natürlich im Rahmen des Machbaren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es da häufig mit Menschen zu tun haben, die sich verletzt und vergessen fühlen, die Sorgen und Unsicherheiten haben, die Halt suchen. Und dann lautet die Devise: Aufklären, aufklären, aufklären – und zwar so respektvoll wie möglich.
Sie plädieren also dafür, dass wir mehr mit den Rechten reden?
Unbedingt. Ich vergleiche das gerne mit meiner Arbeit als Psychotherapeut. Meine Patienten kommen manchmal mit sehr eigenen Einstellungen zu mir. Sie denken von sich, dass sie nichts wert sind, dass sie versagt haben im Leben und man sie nicht lieben kann. Unser erster Impuls ist hier oft, dagegen zu argumentieren – und das machen auch viele meiner Kollegen so. Sie raten dem Patienten dann, seine Denkweise zu ändern. Dabei vergessen wir aber, dass genau diese Einstellung in dem Moment die Lebensrealität des Patienten ist, ob wir das nachvollziehen können oder nicht.
Und wie gehen Sie mit solchen Patienten um?
Ich gehe eher mit Verständnis heran und versuche herauszufinden, wie der Patient zu dieser Denkweise gekommen ist. Es steckt immer eine Geschichte dahinter. Genauso funktioniert das mit dem Rechtsruck auch. Niemand wacht einfach eines morgens auf und will plötzlich die AfD wählen. Da steckt ein Prozess dahinter, Verletzungen und Erfahrungen. Wenn wir nur sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, dann machen wir es uns viel zu einfach. Es geht darum, verstehen zu wollen. Nur so können wir uns einander wieder annähern.