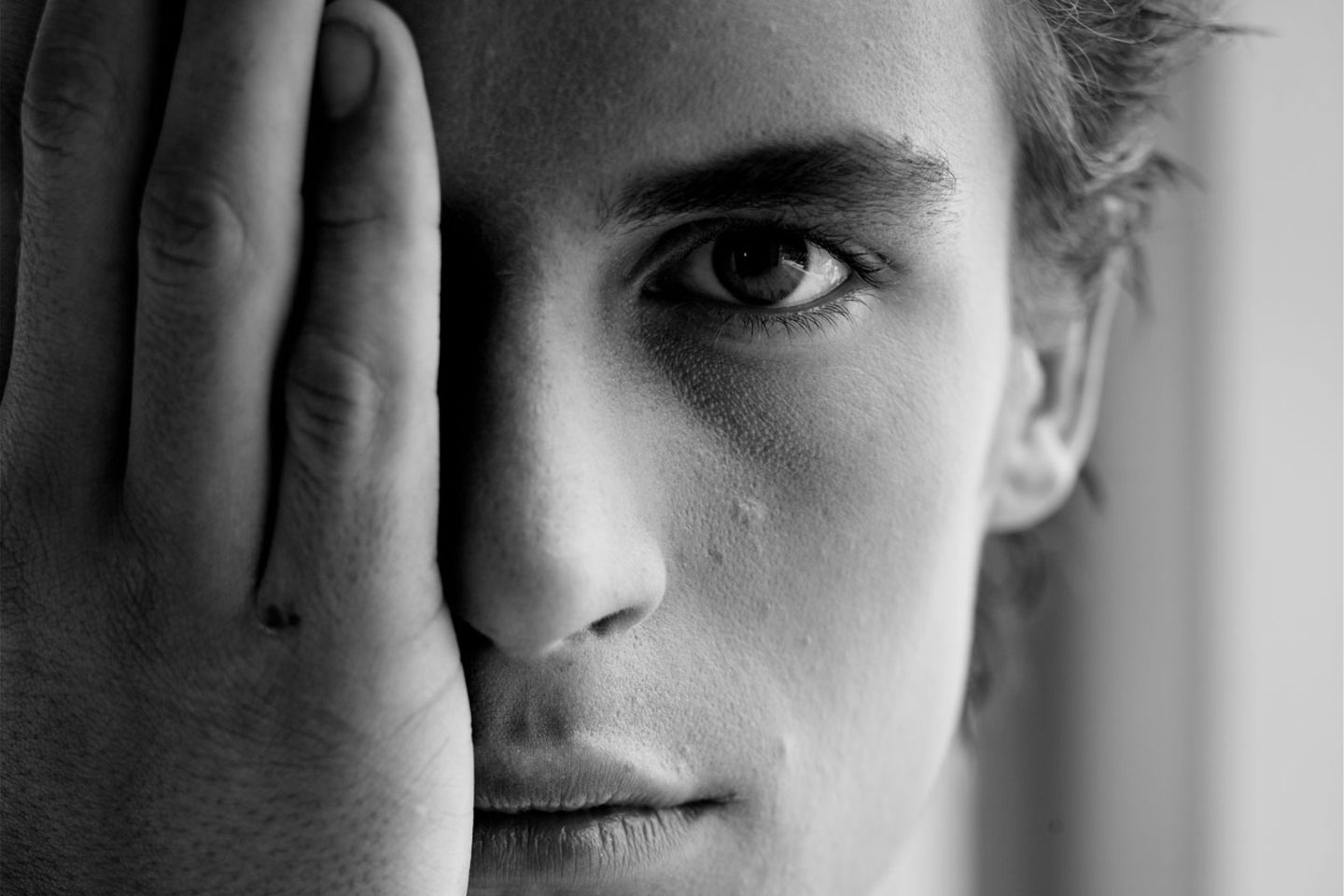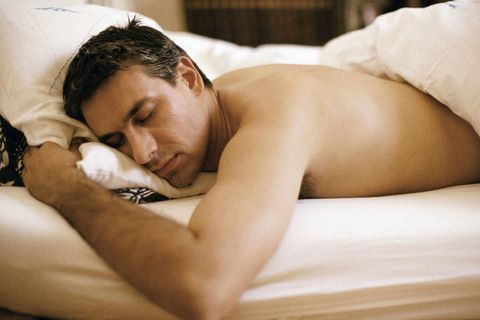Schlaf ist kein monotoner Stand-by-Betrieb von Gliedmaßen und Geist. Vielmehr durchlaufen Kopf und Körper während des Schlummerns verschiedene Phasen: vom leichten Traumschlaf bis hin zum reglosen Tiefschlaf. Diesen Weg nimmt der Mensch innerhalb einer Nacht gleich mehrmals hintereinander: Vier bis sechs solcher Schlafzyklen reihen sich pro Nacht aneinander. Jeder Zyklus dauert rund 90 Minuten.
Wenn Sie sich abends ins Bett legen, entspannen Sie sich mehr und mehr: Atmung und Puls verlangsamen sich, der Blutdruck und die Körpertemperatur sinken. Die Spannung in den Muskeln löst sich. Die Augenlider sind geschlossen, die Augäpfel verharren in einer Stellung. Irgendwann ist das Gehirn so entspannt, dass es von außen kommende Reize wie leise Geräusche oder sanfte Berührungen nicht mehr weiterleitet: Sie sind eingeschlafen.
Wie ein Mensch allmählich eintaucht in die Welt des Schlafs können Forscher anhand eines EEGs verfolgen. Für ein solches Elektro-Enzephalo-Gramm kleben sie mehrere Elektroden auf die Kopfhaut. Die Elektroden zeichnen die Hirnströme auf, die durch die elektrischen Signale der Nervenzellen im Gehirn entstehen. Dieses Gewitter leiten die Elektroden weiter an ein Meßgerät. Es setzt die Ströme um in Kurven: Auf dem Papier oder dem Bildschirm erscheinen große, schwunghafte Wellen, vielleicht aber auch kleine zittrige Zacken, wie von Kinderhand hingekritzelt.
Im Schlaf sprechen die Nervenzellen im Chor
Ist ein Mensch wach, zeichnet das EEG hektisch zitternde Hirnströme auf. Die Linien sind recht flach und die Zacken liegen dicht bei dicht. Das heißt: Viele Nervenzellen sind aktiv, aber sie kommunizieren unabhängig voneinander. Sie sprechen schnell und viele Gespräche überlagern sich - die zitternde Linie entspricht einem Wirrwarr von Stimmen.
In bestimmten Schlafphasen sieht das Bild eines EEGs völlig anders aus: Große Wellen mit weiten Tälern sind dann zu sehen. Das bedeutet: Mehrere Nervenzellen arbeiten zusammen, und sie alle sprechen im Chor, sie kommunizieren im selben Takt. Offenbar ist das Gehirn in einer solchen Schlafphase mit anderen Dingen beschäftigt als am Tag: zum Beispiel damit, Gelerntes als Erinnerung zu festigen.
Im Tiefschlaf träumen wir Gedanken, keine Bilder
Wissenschaftler und Medizinerinnen haben den Schlaf in verschiedene Stadien eingeteilt - jede Phase ist gekennzeichnet durch ein typisches Aktivitätsmuster im EEG. Die Einschlafphase besteht aus den Stadien I und II. Im EEG zeigen sich Hirnströme, die ein wenig glatter und geordneter wirken als die Wellen der Wachheit. Doch der Schlaf ist noch leicht: Menschen, die während der Stadien I und II geweckt werden, meinen, sie seien noch gar nicht eingeschlafen.
Darauf folgt der Tiefschlaf, die Stadien III und IV: Immer größer und weiter werden die Berge und Täler der Hirnstrom-Wellen. Offenbar plaudern die Nerven zunehmend miteinander, sie fangen an, abhängig voneinander zu arbeiten; Nervenbündel bilden einen Verbund, der im Gleichtakt schwingt. Im Tiefschlaf atmet der Schläfer ruhig, seine Muskeln sind völlig entspannt, er bewegt sich kaum. Falls er in diesem Stadium träumt, dann kaum bilderreich oder plastisch, eher ähnelt der Traum einem Gedankenfluss zu einem bestimmten Thema.
Die erste Tiefschlafphase - zu Beginn der Nacht - dauert länger als alle anderen Stadien des Tiefschlafs: etwa eine Stunde. Später verkürzen sich die Tiefschlafphasen immer mehr. Vor allem während der ersten beiden Tiefschlafphasen schüttet die Hirnanhangdrüse Wachstumshormone aus - auch bei Erwachsenen. Sie regen die Reparatur von Zellen an und stimulieren das Immunsystem.
Rollen die Augen, arbeitet das Gehirn wie wild
Auf die Tiefschlafphase folgt der so genannte REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement: Rasche Augenbewegungen unter geschlossenen Lidern sind typisch für dieses Stadium. Der Mensch träumt, rollt mit seinen Augen, zuckt und zappelt.
Während dieser Phase arbeitet das Gehirn wie wild, viele Nervenzellen senden und empfangen Signale. Daher ähneln die EEG-Kurven während des REM-Schlafes denen des Wachzustands: Die Wellen folgen dicht aufeinander, sie sind kurz und klein.
Träumen wir, sind die Muskeln gelähmt
Der Körper aber befindet sich in einer merkwürdigen Verfassung: Die Muskeln sind wie gelähmt - das bewahrt den Schläfer davor, seine Träume körperlich auszuleben. Ausgenommen sind Schlafwandler; allerdings gehen sie meist in der Tiefschlafphase auf Wanderschaft.
In der REM-Phase sind viele Hirnregionen sehr aktiv, vielleicht senden die Nerven aus dem Bewegungszentrum gerade Signale an die Beine: Der Schläfer möchte im Traum davonlaufen. Doch das Stammhirn sorgt dafür, dass alle Impulse an die Muskeln unterdrückt werden. So zucken die Beine nur - was die Schlafenden im Traum selbst als lähmende Behinderung wahrnehmen können.
Während der Traumphause schlägt das Herz schnell und unregelmäßig, der Blutdruck steigt, die Körpertemperatur sinkt. Das Gehirn verbraucht fast so viel Energie wie im Wachzustand. Menschen, die während des REM-Schlafes geweckt werden, berichten fast immer von aufregenden Träumen.
Auf die erste, relativ kurze REM-Schlafphase folgt wieder eine längere Tiefschlaf-Periode. Dieser Wechsel wiederholt sich insgesamt vier bis sechs Mal pro Nacht. Je näher der Morgen rückt, desto kürzer wird der Tiefschlaf und desto länger der REM-Schlaf.
Zum Ende der Nacht bereitet sich der Körper aufs Aufwachen vor
Die Körpertemperatur sinkt zu Beginn der Nacht, ihren Tiefpunkt erreicht sie durchschnittlich zwischen drei und vier Uhr. Danach steigt sie wieder an. Im letzten Drittel des Schlafes steigt auch die Konzentration des Stresshormons Kortisol im Blut an: So bereitet sich der Körper auf den kommenden Tag vor.
In der Stunde vor dem Aufwachen klettert das Gehirn aus den Tiefen des Schlafs langsam wieder an die Oberfläche hinauf: Es bleibt in den Schlafstadien II und I, es döst. Klingelt dann der Wecker, fällt das Aufstehen nicht schwer.
Ute Kehse