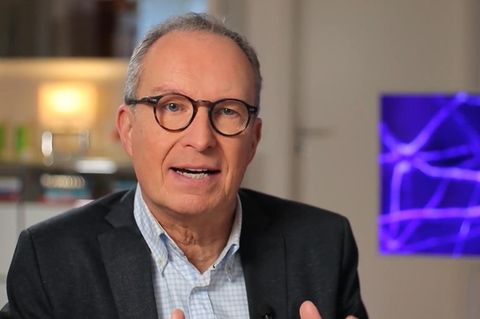Wieso sind Stammzellen so begehrt?
Die meisten Zellen in unserem Körper sind sozusagen Facharbeiter, was sie gleichzeitig unflexibel werden lässt. So macht eine Leberzelle zwar einen perfekten Job in der Leber, kann aber niemals zur Hautzelle werden - und umgekehrt. Die Stammzelle hat noch kein Spezialgebiet, sie kann sich noch in jede Richtung entwickeln. Deshalb können Stammzellen theoretisch jedes zerstörte Gewebe im Körper erneuern oder ersetzen. Das macht sie so wertvoll.
Was sollen Stammzellen einmal leisten?
Stammzellen könnten viele Krankheiten heilen, bei denen ein bestimmtes Gewebe im Körper geschädigt ist. Bei Menschen mit Diabetes Typ-1 sind beispielsweise bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, die das Stoffwechselhormon Insulin produzieren. Nur aus diesem Grund leiden Betroffen an Diabetes. Könnten die Zellen durch eine Stammzelltherapie ersetzt werden, wären sie geheilt. Ebenso könnten Stammzellen Herzzellen, die bei einem Infarkt zugrunde gegangen sind, ersetzen. Oder bei Parkinson-Patienten könnten Stammzellen zerstörte Nervenzellen ersetzen.
Was ist der Haken an der Sache?
Es gibt gleich mehrere. Embryonale Stammzellen sind ethisch umstritten (siehe: Wieso ist die Forschung mit embryonalen Stammzellen umstritten?).
Außerdem wissen Forscher nicht genau, wie sie Stammzellen dazu bringen, sich zu einem bestimmten Zelltyp zu entwickeln - geschweige denn eine so komplexe Struktur wie ein ganzes Organ zu bilden. Stammzellen richten sich nach ihrer Umgebung, wenn sie ihr Spezialgebiet wählen und die komplexen Signale, die zusammenwirken, damit aus Stammzellen Muskeln, Bindegewebe oder Nerven werden, hat man noch nicht entschlüsselt.
Ein drittes Problem treibt deutsche Forscher um: Die embryonalen Stammzellen, mit denen hierzulande geforscht werden darf, müssen vor dem 1. Januar 2002 entstanden sein. In so einem langen Zeitraum mutieren einige Zelllinien, so dass sie der Forschung kaum noch nutzen und für einen therapeutischen Einsatz sowieso nicht mehr taugen. Zudem sind diese Zellen durch frühere Techniken mit tierischen Zellen verunreinigt.
Embryonal, adult und "induziert pluripotent": Was ist der Unterschied?
Embryonale Stammzellen sind die ersten Zellen, die direkt nach Verschmelzung von Eizelle und Spermium entstehen. Sie können sich in jede der mehr als 200 Zellarten des Körpers entwickeln. Aus den ersten acht embryonalen Stammzellen kann sogar noch ein ganzes Lebewesen entstehen - so können auf ganz natürliche Weise eineiige Zwillinge entstehen. Spätere embryonale Stammzellen können zwar noch sämtliche Zellarten bilden, aber kein Lebewesen mehr.
Adulte Stammzellen haben schon einen Schritt der Spezialisierung hinter sich und können nur noch zu bestimmten Zelltypen werden: So gibt es etwa blutbildende Stammzellen, die jede Form der Blutkörperchen bilden können, aber keine Nerven- oder Muskelzellen. Der Vorteil dieser Zellen: Jeder Mensch besitzt sein Leben lang in vielen Organen ein Reservoir dieser Zellen. Das erleichtert es, sie zu erforschen und medizinisch zu nutzen.
Neu sind induziert pluripotente Stammzellen: Wissenschaftlern in Japan und den USA ist es kürzlich gelungen, im Labor "normale" Zellen aus Haut und Bindegewebe so umzuprogrammieren, dass sie embryonalen Stammzellen extrem ähnlich sind. Zu ihrer Erzeugung werden weder Eizellen noch Embryonen benötigt.
Wieso ist die Forschung mit embryonalen Stammzellen umstritten?
Um embryonale Zellen zu gewinnen, müssen Forscher einen Embryo zerstören, sie vernichten also ein potenzielles Leben. In Deutschland ist es verboten, zur Forschungszwecken Embryonen zu verbrauchen.
In den Ländern, in denen dies erlaubt ist, nutzen Forscher Embryonen, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind. Sie zerstören diese zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn aus der befruchteten Eizelle gerade ein mikroskopisch kleiner Zellhaufen entstanden ist. Wenn Frauen mit einer Kupferspirale verhüten, können sich Embryonen bis zu diesem Stadium entwickeln, da die Spirale die Befruchtung der Eizelle nicht beeinflusst, sondern lediglich verhindert, dass sich der Embryo in die Gebärmutter einnistet.
Haben embryonale Stammzellen etwas mit Klonen zu tun?
Ja. Das so genannte therapeutische Klonen zielt nur darauf ab, embryonale Stammzellen fürs Labor zu erzeugen. Beim reproduktiven Klonen wird die Kopie eines Tieres erzeugt – das erste geklonte Säugetier war das Schaf Dolly. Beim therapeutischen Klonen stellen Forscher zwar einen Embryo her, dieser geht jedoch in einer Zelllinie auf. Die embryonalen Stammzellen vom Menschen wurden allerdings nie auf diese Weise erzeugt. Sie stammen aus Embryonen, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind.
Wie entstehen induziert pluripotente Stammzellen?
Die zwei Wissenschaftlerteams aus Japan und den USA, die menschliche Zellen umprogrammiert haben, nutzten dafür so genannte Retroviren. Diese Viren schleusen ihr Erbgut direkt in das Erbgut der befallenen Zelle ein. Die Forscher bestückten die Viren mit je vier verschiedenen Genen, welche die Umprogrammierung zur Stammzelle einleiten. Die Forscher nahmen nicht dieselbe Kombination von Genen, es scheint also verschiedene Wege zurück zur Stammzelle zu geben. Noch ist der Prozess sehr ineffizient: Das Team um den Japaner Yamanaka programmierte eine von 5000 erfolgreich um, bei der Gruppe um den US-Amerikaner Thomson war nur einer von 10.000 Versuchen erfolgreich.
Sind induziert pluripotente Stammzellen eine Alternative für die embryonalen?
Noch nicht, erst müssen Wissenschaftler herausfinden, inwieweit sich die umprogrammierten Zellen von echten embryonalen Stammzellen unterscheiden. Deshalb können sie noch nicht auf den Einsatz embryonaler Stammzellen verzichten. Langfristig können die induziert pluripotenten Zellen allerdings die bessere Alternative sein.
Ein weiteres Problem: Noch bringen die induziert pluripotenten Zellen ein höheres Krebsrisiko mit sich, was gegen einen Einsatz als Heilmittel spricht. Das erhöhte Krebsrisiko kommt durch den Einsatz der Retroviren, die bei ihrer Arbeit die DNA - das Erbgut - der Zelle zerschneiden.
Werden Stammzellen schon medizinisch genutzt?
Adulte Stammzellen aus dem Knochenmark kommen bei der Therapie von Leukämie und Lymphomen bereits seit Jahrzehnten zum Einsatz. Davon abgesehen werden Stammzellen bislang nur im Rahmen klinischer Studien getestet, zum Teil aber mit sehr guten Ergebnissen, etwa bei der Behandlung nach einem Herzinfarkt.
Was sind die nächsten Schritte?
Wissenschaftler überlegen derzeit, wie sie Zellen ohne den Einsatz von Viren umprogrammieren können. Theoretisch ist dies möglich, denn die von den Viren eingeschleusten Gene sind ja alle bereits in den Zellen vorhanden, sie sind nur nicht aktiv genug. Adulte Stammzellen werden bereits in vielen klinischen Studien geprüft.