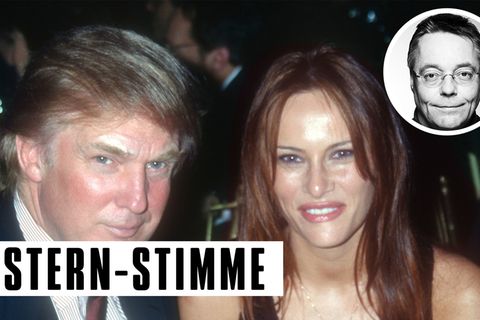Wenn man gebeten wird, das Buch eines lieben Kollegen zu besprechen, findet man sich schnell in einer Zwickmühle wieder: Was tun, wenn das Buch hundsmiserabel ist? Nun, in diesem Fall drückt man sich um die Rezension herum, bis vergessen ist, dass man etwas schreiben wollte. Im zweiten, positiven Fall schreibt man einfach los - woraus Sie, verehrte Leser, nun schon Ihre Schlüsse ziehen können.
Mit dem Michael Streck verhält es sich so: Er ist in der stern-Redaktion recht beliebt. Nicht nur, weil er ein freundlicher, hilfsbereiter Kollege ist, mit dem man zudem auch mal ein, zwei Schoppen trinken kann. Nein, den Streck mögen wir vor allem wegen seiner Geschichten: Die sind manchmal traurig, oft sehr, sehr komisch, mitunter ätzend - und immer: spannend. Als wir also von seinem Buchprojekt hörten, fragten wir uns nur: Schafft er den Sprung von 300 Zeilen auf 300 Seiten? Nun: Er schaffte ihn.
Das Buch
"Stars & Stripes und Streifenhörnchen: Unsere Jahre in Amerika" von Michael Streck, 2008, Malik Verlag, 19,90 Euro. Illustriert hat das Buch stern-Cartoonist Til Mette
Das liegt daran, dass "Stars & Stripes und Streifenhörnchen" eben kein vordergründig politisches Buch ist. Dabei muss die Versuchung für einen USA-Korrespondenten groß gewesen sein, immerhin hatte Streck die Politik der Bush-Regierung sieben Jahre lang täglich auf dem Schreibtisch liegen. Der Präsident taucht im Buch dann auch durchaus auf, aber eben nur als Leitmotiv und als Vergleichsmaßstab etwa dieser Art: "Raucher sind in New York ungefähr so beliebt wie Osama Bin Laden oder George W. Bush." Mehr sagt Streck nicht zum Texaner, und, mal ehrlich: Mehr braucht es auch nicht.
Liebeserklärung statt Polit-Gejammer
Es gibt nur ein Kapitel im Buch, dass ein Ereignis von globaler Tragweite thematisiert, es sind die Seiten zum 11. September 2001, sie stehen gleich am Anfang des Buches, was sich daraus ergibt, dass Streck seinen Dienst in New York nur knapp zwei Wochen vor dem Anschlag antrat. Und ja, dieses Kapitel ist traurig, mehr als einmal atmet man beim Lesen tief durch und blickt über die aufgeschlagene Seite hinaus. Streck aber lässt uns nicht im Jammertal hocken, er beendet den düsteren Abschnitt mit einer Liebeserklärung an jenes Land, das ihn und seine Familie sieben Jahre lang beherbergte: In den Tagen nach dem Inferno riefen wir, Freunde und Kollegen, die Strecks natürlich an, wollten wissen, wie sie durchhielten und fragten dann alle unisono, wann die Familie denn nun nach Hause käme. Worauf Michaels Ehefrau, die ebenso nette und noch schlauere Annette, erwiderte: "Was wollt ihr? Wir sind zu Hause."
Nach diesen dunklen Tagen akklimatisierten sich die Strecks recht schnell, und das Buch wird nun, für US-Kenner und Amerika-Frischlinge, so richtig, manchmal brüllend komisch. Am lustigsten sind jene Kapitel, die sich mit dem Rauchen und Trinken beschäftigen, jenen lässlichen Lastern, die Streck aus Europa mitgebracht hatte. Und die Amerika keineswegs tolerieren mochte. Streck berichtet, wie seine jüngere Tochter Merle (wie ihre Schwester Hannah ganz die Mama) zur aufrechten No-smoking-Fundamentalistin konvertierte und fortan Schulaufsätze schrieb, deren Thema beispielsweise war: "Wie mein Vater uns alle systematisch durch Second-hand-smoke tötet". Nach Lektüre dieser Passage ist dann auch klar, warum George Bush in diesem Buch nur eine Nebenrolle zufällt: Es gab härtere, dramatischere Herausforderungen.
Von skurrilen Gesetzen und einem Zuhause fern der Heimat
Müssen wir noch erwähnen, dass es bei der dann doch unausweichlichen Rückkehr der Strecks einen Weinhändler gab, der seine ganz persönliche Finanzkrise zu bewältigen hatte? Dass die Strecks auch nach sieben Jahren nicht zu religiösen Fundamentalisten wurden, obwohl sie jede Menge trafen und die ältere Tochter schließlich fragte: "Wenn Jesus wirklich Wein aus Wasser gemacht hat, wieso dürft ihr dann keinen trinken?" Nein, das muss nicht betont werden. Wohl aber, dass die Familie sehr viel lernte: Dass eine amerikanische Pizza für zwei europäische Kleinfamilien reicht. Dass man in Alaska kein Bier an Elche verkaufen darf (aber vielleicht an Sarah Palin). Und dass die Töchter schließlich das sinnvollste Gesetz Amerikas entdeckten: Es gilt im Bundesstaat New Mexico und verbietet Idioten das Wählen des nächsten Präsidenten. Wenn dieses Gesetz im ganzen Land gegolten, wäre dieser wundervollen Nation jede Menge Ärger erspart geblieben.
Falls nun jemand denkt, den Strecks hätte es in den USA nicht gefallen, dem sei soviel verraten: Sie wollten nicht zurück. Nein, nein, nein. Streck schreckte vor keinem Intensiv-Gespräch mit der Chefredaktion zurück, um ihr noch ein weiteres Jahr da drüben abzuhandeln. Und als die Chefs sich nicht mehr erweichen ließen, ging die Familie zum letzten Mal auf eine sehr lange Reise durch ihr Lieblingsland - und erlebte noch einige schreibenswerte Geschichten, allein diese lohnen schon den Kauf des Buches.
Jetzt sind sie also wieder zu Hause: Streck darf auch in Deutschland nicht rauchen, wo er mag. Die Töchter sprechen immer noch lieber Englisch. Aber zu Hause sind sie, auch wenn dieser Platz in Hamburg nun etwas ist, für das es in den USA einen feinen Ausdruck gibt: A home away from home.