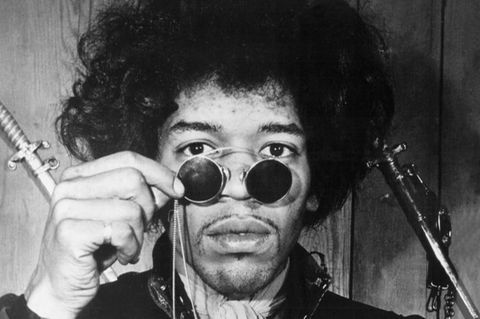So lang hat es wohl selten gebraucht, eine Platte auf den Markt zu bringen. Als Harry Belafonte 1954 anfing, Lieder für seine Anthologie schwarzer Musik zu sammeln, war er ein junger Mann aus Harlem, den außerhalb von New York kaum jemand kannte. Als »The Long Road to Freedom« endlich erschien, 48 Jahre später, war Belafonte 75 Jahre alt und ein Weltstar.
Seine einzigartige Stimme, samtig weich und doch kratzig, hatte Anfang der 50er Jahre den Chef der Plattenfirma RCA begeistert. George Marek besaß einen einmaligen Riecher. Er förderte nicht nur die schwarze Opernsängerin Leontyne Price und verpflichtete diesen aufstrebenden jungen Mann namens Elvis Aaron Presley. Er witterte auch, lange vor allen anderen, dass der hübsche Harry Belafonte aus Harlem ein Ausnahmetalent war. Marek lag goldrichtig: Die LP »Calypso« mit den Hits »Banana Boat Song« und »Matilda« wurde 1956 zu einem überragenden Erfolg, es war die erste Platte der Musikgeschichte, von der in einem Jahr mehr als eine Million Stück verkauft wurden.
Derweil arbeitete Belafonte wie besessen an seinem Lieblingsprojekt. Mit Liedern wollte er den »langen Weg in die Freiheit« jener Amerikaner nachvollziehen, »die einst als Gefangene aus Afrika gekommen waren«. RCA-Chef Marek begeisterte sich sofort dafür. Er war ein Wiener Jude, der 1920 in die USA gegangen war: »Er wusste, was Unterdrückung ist«, sagt Belafonte. Marek gab ihm grünes Licht und Geld. Doch die Bosse, die nach ihm kamen, wollten nur einzelne Stücke, die sie für kommerziell verwertbar hielten, auf Platte pressen.
Nun kommen die fünf CDs auch auf den deutschen Markt. Sie beginnen mit Kriegsgesang der westafrikanischen Ashanti aus dem 17. Jahrhundert, gehen über nigerianische Kinderlieder, frühe Spirituals, kreolische Chöre aus dem Mississippi-Delta, Arbeits-, Gefängnis- und Plantagenlieder, Blues und Gospel bis zu den Balladen der großen Städte. Die Reise endet um das Jahr 1900.
Mr Belafonte, warum hat es so lang gedauert, diese Anthologie zu veröffentlichen?
Weil es nur um Profit geht in der Plattenindustrie, um nichts anderes. An den Künstlern hat niemand Interesse, man ist ein Gebrauchsartikel, der nur nach seinem kommerziellen Wert eingestuft wird. Es genügt nicht, ein bisschen Profit zu machen, es muss viel, viel Geld sein, sonst sagt sich diese Industrie: Warum soll ich so viel Arbeit in ein Projekt stecken, an dem ich nur mäßig verdiene? Da investieren wir doch lieber in die nächste Britney Spears und verdienen irrsinnig viel.
War das denn früher anders?
George Marek war ein gebildeter Mann, er gab seinen Künstlern das Gefühl, sie seien unersetzlich und einmalig. Ich glaubte doch, die Sonne könne am Morgen nicht gegen meinen Willen aufgehen - so hat er mich gefördert. Es ging immer auch um Geld, sicher - aber heute geht es ausschließlich darum. Dieses Profitstreben hat unsere Kultur in den Abgrund gestürzt. Es wird nur noch produziert, was sich massenhaft verkauft. Geldgier ist der zentrale Faktor unserer Kultur, Geldgier bestimmt unser Leben als Nation.
Da sind die Amerikaner aber nicht allein.
Doch. Die Raffgier-Maschine ist eine überwiegend amerikanische Kraft, sie ist global die erfolgreichste. Dem Kerl, der in Amerika sitzt, gehört meist auch der Betrieb in Deutschland.
Oder umgekehrt. Wir sitzen hier im Bertelsmann Building in New York...
Wir werden, wie mein Freund Robert Altman sagt, immer mehr eine Monokultur. Die Grammys zum Beispiel spiegeln die ganze Vulgarität unserer Epoche wider, Sodom und Gomorrha können kaum korrupter gewesen sein. Und doch geht jeder hin. Aus Geldgier.
Dabei geht es der Musikindustrie so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht...
Gut so! Keiner weiß mehr so recht, was tun? Gut so! Die Industrie bringt sich selber um. Die Menschen sind es leid, von dieser Marketingmaschine reingelegt zu werden. Wenn die Musikindustrie überleben will, muss sie sich ändern. Das ist ein guter Zeitpunkt für alle Kreativen, etwas Neues zu schaffen. Die Frage ist nur: Werden sie den Kollaps auch nutzen?
Kunst gegen Kommerz, der Streit beherrscht auch die Filmindustrie.
Ich finde es faszinierend, dass die meisten Filme mittelmäßig sind, wobei die Technik unglaublich fortgeschritten ist. Der schlechteste Film, den ich im vergangenen Jahr gesehen habe, war »Pearl Harbor«, und die Technik war hervorragend. Wenn man sie nur nützen würde, um etwas zu schaffen, was die Menschheit weiterbringt.
Aber werden nicht bei den Oscars auch manchmal gute Filme...
...die Oscars gehen mir auf den Wecker! Da sitzen wir Künstler in Verehrung zu Füßen der Kinoindustrie und feiern unsere Herren - dabei sind wir doch die Bosse! Ohne uns würde gar nichts passieren! Was wäre wohl los, wenn wir sagten: Wir machen die kulturelle Korruption nicht mehr mit, nächstes Jahr kommen wir einfach nicht!
Bei der jüngsten Verleihung waren schwarze Künstler sehr erfolgreich. Stimmt Sie das nicht optimistisch?
An dem Punkt waren wir schon oft, man hielt es für ein Signal, als Sidney Poitier vor fast vierzig Jahren seinen ersten Oscar bekam. Das dachte man auch, als Denzel Washington 1990 seinen ersten Oscar bekam, und man denkt es bei jeder Gelegenheit, bei der ein Schwarzer irgendeinen Erfolg hat. Immer heißt es: historisch! Wie weit es die Schwarzen doch gebracht haben!
Aber drei Oscars - waren Sie nicht ein bisschen stolz?
Nein. Sidney Poitier, Denzel Washington und Halle Berry sind großartige Schauspieler. Aber was sagen ihre Oscars über Hollywood? Absolut nichts. Es ist so rassistisch wie immer, heute nur nicht mehr so offen. Aber in die große Wunde unserer Geschichte vordringen, das will bis heute niemand.
Steven Spielberg hat 1997 mit »Amistad« einen Film über Sklaverei gemacht - ein Flop. Er sagte damals, Amerikaner blickten eben nicht gern zurück. Warum ist Sklaverei bis heute kein Thema in den USA?
Wir Amerikaner wollen nicht sehen, was wir anderswo anrichten, ob das in Afrika ist oder sonstwo. Wir reklamieren für uns eine Moral, die größer und besser ist als die von irgendjemand anderem im Universum. Wir sind das reine Volk, die Beschützer der Demokratie. Wir sind die Gerechtesten. Wir sind diejenigen, die Gott am meisten liebt. Aber in unserem Weltbild kommt gar nicht vor, dass auch wir Fehler haben. Wir wollen nicht verstehen, woher wir kommen und was wir in der Vergangenheit getan haben. Und wir leiden darunter fürchterlich, bis heute.
Warum wollen Amerikaner immer so gern andere zu ihren Werten bekehren?
Der Völkermord an den Indianern oder die Versklavung der Afrikaner wurde damit gerechtfertigt, die »Heiden« müssten zu einer höheren Zivilisation bekehrt werden. Und bis heute sträubt sich Amerika, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Uns fehlt jeder Sinn für Verantwortung, weil wir alles nur nach jenem Maßstab messen, den wir für den einzig wahren halten - Geld. Du bist so gut wie dein Bankkonto. Ob in der Wissenschaft, ob in der Kultur - wir schätzen nur, was sich in Geld umsetzen lässt.
Sie sind gerade 75 geworden - aber kein bisschen leiser. Woher diese rebellische Ader?
Es gibt diesen alten Spruch: Wenn man dich lang genug in Ketten hält, siehst du dich selbst als Menschen zweiter Klasse. Dann glaubst du auch nicht, du könntest all die wunderbaren Dinge erreichen, die der weiße Adonis kann. Ich komme aus einer sehr armen Familie in Harlem und habe früh gelernt, mich durchzuschlagen. Zum Glück hatte ich eine Mutter, die vollkommen frei war von dieser Zweite-Klasse-Mentalität. Sie war widerspenstig, kampfbereit und aggressiv. Und irgendwie siegte sie immer. Niemand hat mich so geprägt wie sie.
Interview: Claus Lutterbeck