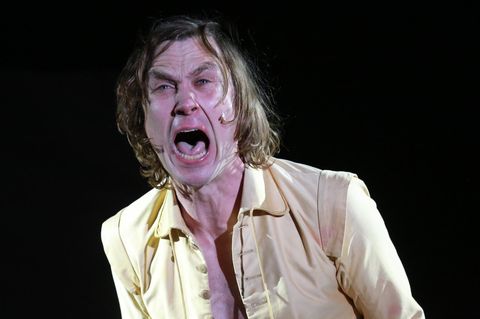Fliegende Autos? Organe aus dem Drucker? Jacken, die ihren Träger bei einem Unfall selbstständig wieder beleben? Ein riesiger Aufzug ins All? So spektakulär sieht also unsere Zukunft aus. Nur: Man muss es erst einmal glauben. Und das fällt schwer, nach all den Science-Fiction-Märchen, die Hollywood schon durchs Kino gespült hat.
Schwerer noch als in der Zukunft zu leben, ist es wohl, sich dieselbe aus der Gegenwart vorzustellen, ohne dass es albern wirkt. So gesehen ist die Doku "2057 - Unser Leben in der Zukunft", die Arte und das ZDF an diesem Wochenende zeigen, ein riesiger Reinfall. Weil kaum etwas von dem, was dort prognostiziert wird, glaubwürdig ist. Bis man prompt die Belege aus der Forschung vorgeführt bekommt und sich denkt: Das kann doch wohl nicht wahr sein!
Wie bei den Gebrüdern Wright
"2057" ist ganz und gar kein Reinfall, sondern ein interessantes Experiment, zu visualisieren, wie die Menschen in 50 Jahren auf diesem Planeten leben werden. In hochtechnisierten Haushalten, mit künstlich gezüchteten Herzen, in vernetzten Städten mit empfindlichen Datensystemen, immer noch auf der Suche nach der Antwort auf den unglaublichen Energiehunger, den die Weltbevölkerung entwickelt hat.
"2057 - Unser Leben in der Zukunft"
ist heute, am Freitag, ab 13 Uhr vorab auf zdf.de zu sehen. Arte zeigt die drei Teile ab morgen jeweils samstags um 20.45 Uhr, das ZDF sonntags um 19.30 Uhr.
Vor allem lebt "2057" vom Überraschungseffekt - weil eben nicht bloß Behauptungen aufgestellt werden und hübsche Animationen futuristischer Städte gezeigt, sondern auch Wissenschaftler zu Wort kommen, die jetzt und heute genau daran arbeiten, dass es diese Zukunft geben kann.
Ja, ja, denkt sich der Zuschauer erst: Autos, die senkrecht in die Luft gehen und geradeaus durch die Luft fliegen können, wenn am Boden Stau ist, das kennt man schon zur Genüge. Umso überraschender ist die Erkenntnis, dass es tatsächlich Forscher gibt, die solche Fahrzeuge schon entwickelt haben, wie nachher per Video-Einspieler bewiesen wird. Die Angelegenheit ist noch furchtbar wackelig und das Gefährt kommt kaum ein paar Meter voran - aber das Prinzip funktioniert. Auch die Gebrüder Wright haben klein angefangen.
Manchmal hoffnungslos optimistisch
Dass die Doku ihren Effekt erzielt, liegt in dieser Verknüpfung des eigentlich Unglaublichen mit dem Nachvollziehbaren, den Bildern aus dem Labor, in denen es tatsächlich geschafft wird, künstliche Herzklappen zu züchten, die anschließend auf die von ihnen verlangte Leistung trainiert werden müssen, und vielleicht schon in ein paar Jahren bei Operationen verwendet werden könnten. In den USA gibt es tatsächlich Forscher, die einen einfachen Tintendrucker so umgebaut haben, dass sie Bakterienkulturen in den von ihnen gewünschten Mustern damit auf Papier bringen konnten. Warum sollten sich auf diese Weise nicht auch dreidimensionale Organe "ausdrucken" lassen?
In drei Teilen zeigt "2057", wie sich die Medizin weiterentwickeln könnte, wie die Stadt der Zukunft aussehen würde, wie die globale Energiekrise gelöst werden könnte. Manches davon ist nachvollziehbar, anderes einfach hoffnungslos optimistisch.
Dabei kommt die kritische Distanz zum Fortschritt oft zu kurz: Zwar beschreibt die Doku, wie anfällig die komplexen Steuerungssysteme der Zukunft sein werden, und dass große Versicherungsunternehmen all denen, die sich nicht an die gesundheitlichen Vorschriften halten, die Versorgung entziehen - aber an keiner Stelle wird die Frage gestellt, ob wir wirklich so leben wollen?
Ansatzpunkte, die Mut machen
Die Möglichkeit, dass die Menschen darauf verzichten, sich trotz möglichen Sicherheitsvorteile rund um die Uhr beobachten und bewachen zu lassen, und die Gefahr, die ein Kontrollorgan ausüben könnte, das die Macht über all das besitzt, sind kein Thema - auch wenn in der dritten Folge immerhin auf mögliche politische Querelen der künftigen Supermächte eingegangen wird.
Wenn man darüber hinwegsieht, ist man nach Ansicht der Doku um einiges schlauer - vielleicht sogar hoffnungsvoller. Während in den Nachrichten Klimakatastrophe und Energiekollaps vorausgesagt werden, bietet "2057" kleine Ansatzpunkte, die Mut machen, einfach weil es Wissenschaftler zu geben scheint, die tatsächlich an der Lösung der Probleme arbeiten und sie nicht bloß wie Politiker in Grund und Boden diskutieren. Was freilich nicht bedeutet, sich zurück lehnen zu können und bloß abzuwarten.
Die große Schwäche von "2057" sind die aufgesetzt wirkenden Spielszenen, die als Verknüpfung der unterschiedlichen Erkenntnisse funktionieren sollen - und vermutlich dem Zuschauer signalisieren, dass er keine trockene Wissenschaftsdoku ansehen muss. Das geht in Ordnung, doch hätten die Autoren gut daran getan, sich nicht gleich kleine Dramen auszudenken: einen Arzt, der nach einem Unfall, von seiner ärgsten Konkurrentin operiert werden soll; einen greisen "Old School Hacker", der eine komplette Stadt lahm legt; ein Astronauten-Team, das im Streit zwischen China und den USA zwischen die Fronten gerät.
Wissenschaft ist spannend genug
Das alles ist sehr pathetisch geworden, zu sehr übertrieben, um noch seriös zu wirken, und oft einfach überflüssig: Die Macher hätten ruhig darauf vertrauen können, dass das, was sie über die Zukunft erzählen wollen, spannend genug ist.
Macht nichts: "2057" ist in jedem Fall sehenswert, und dem ZDF nach "2030 - Aufstand der Alten" schon die zweite spannende Zukunftsprognose in diesem Jahr gelungen. Was sich davon bewahrheitet, wird sich so schnell nicht herausfinden lassen. Vielleicht lachen die Menschen in 50 Jahren auch über die hoffnungslos veraltete Prognose ihrer Vorfahren.
Oder sie sind enttäuscht. Wenn man überlegt, wie schwer sich heute schon viele damit tun, sämtliche Funktionen ihres Handys zu nutzen, und wie umständlich es sein kann, einen einfachen DSL-Anschluss zu beantragen, ist man sich jedenfalls nicht mehr ganz so sicher, ob das mit dem hochtechnisierten Fortschritt wirklich so einfach werden wird.