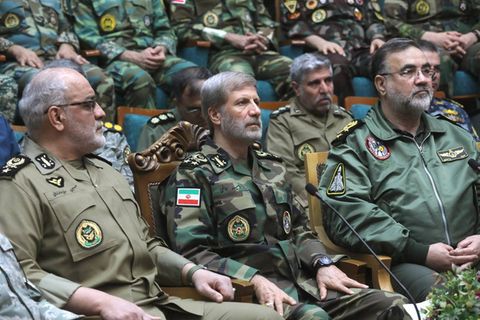Stellen wir uns einmal vor, wir säßen auf dem heißen Stuhl bei "Wer wird Millionär", gegenüber von Günther Jauch, vor uns auf dem Bildschirm eine Frage, vier Antwortmöglichkeiten und eine Zahl, die vielleicht noch keine Million ist, aber immer noch mehr, als wir je auf unserem Konto gesehen haben. Wir entscheiden uns für eine Antwort, wir loggen sie ein, wie das in der Quizshow-Sprache heißt. Im Hintergrund wabert spannungsgeladene Musik. Der Puls rast. Günter Jauch, der irgendwie kleiner aussieht als sonst im Fernsehen, schaut uns an. Und schweigt. Wir sitzen da. Und warten. Vielleicht lässt sich so die Quarterlife-Crisis beschreiben. Jene Sinnkrise, in die viele junge Menschen im Alter von Mitte, Ende 20 stürzen, weil sie sich fragen: Habe ich im Leben die richtigen Antworten gegeben? Was, wenn ich daneben lag? Und wie geht das Spiel dann weiter?
"Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten", hat schon Hape Kerkeling, der Günter Jauch unserer Eltern, gesungen: "Und wir raten, raten, raten." Eigentlich nämlich stellt das Leben permanent Fragen an uns, die wir beantworten müssen. Oft gibt es mehr als nur vier Möglichkeiten, manchmal hilft ein Joker und möglicherweise sitzt auch irgendwo so etwas wie ein allwissender Quizmaster, der ab und zu einen sanften Schubs in die richtige Richtung gibt. Die Antworten aber muss schon jeder selbst geben.
Habe ich die richtige Ausbildung oder das richtige Studium gemacht? Bin ich im richtigen Beruf gelandet? Lebe ich in der Stadt, in die ich hineinpasse?
Quarterlife-Crisis: Auf jede Antwort folgt eine neue Frage
Unter der Quarterlife-Crisis versteht man meistens eine Krise in einer Übergangsphase. Zum Beispiel an der Schwelle zwischen Studienabschluss und Berufseinstieg oder dann, wenn es darum geht, sich festzulegen auf einen Partner, eine Stadt oder einen Lebensentwurf. Normalerweise sind Menschen zwischen 25 und 30 davon betroffen. Und besonders häufig schlägt sie rund um Geburtstage zu, besonders bei den (halb-)runden.
Dann wird das Leben einer Generalinspektion unterzogen. Sorgsam wird abgewogen, was man erreicht hat, wo man gescheitert ist und ob man der geworden ist, der man werden wollte. Eigentlich ist das ja auch logisch: Je länger man lebt, desto mehr Zeit hatte man, Fehler zu machen. Und je kürzer man noch zu leben hat, desto weniger Zeit hat man, diese wiedergutzumachen.
"You'd think after twenty-two years / I'd be used to the spin" hat die Band Bright Eyes in ihrem ikonischen Song "Landlocked Blues" gesungen. Aber auch ein gutes Stück nach den 22 Jahren haben viele junge Menschen immer noch nicht endgültig herausgefunden, wie genau sich die Welt denn dreht. Das Alter, das man als Teenager für geradezu biblisch und deshalb auch mit entsprechender Weisheit gesegnet empfunden hat, erweist sich als fast noch verwirrender als alles zuvor.
In diesem Alter sind wir so weit, selbst genug Antworten gegeben zu haben, die wir nun evaluieren können. Davor sind wir zu oft Produkte von Entscheidungen, die andere für uns getroffen haben – die Eltern, die Schule, das Lebensumfeld. Mit Mitte oder Ende 20 hat man sich selbst einen Lebensweg und -stil gesucht, sich für ein Studium oder eine Ausbildung entschieden, man hat Ja oder Nein gesagt zu Möglichkeiten und Menschen. Dann, mit ein paar Jahren Abstand, fragt man sich: Und was, wenn das alles falsch war?
Wäre ich doch lieber bei der Ex-Freundin geblieben? Hätte ich doch den Job in Berlin annehmen sollen? Wäre nicht alles einfacher gewesen, wenn ich in meiner Heimatstadt geblieben wäre? Warum habe ich mich gegen den Traumberuf und für die vernünftige Variante entschieden?
Zwanziger werden mit ihren Problemen nicht ernstgenommen
Die Midlife-Crisis ist seit vielen Jahren bekannt. Wenn jemand in seinen Vierzigern alles infrage stellt, nicken die meisten um ihn herum mit einer Mischung aus Wissen und Mitleid. Manche lassen sich dann scheiden, manche gehen auf Weltreise, bei anderen reicht es schon, sich die Haare zu färben. Doch wenn ein twenty-something in ein existenzielles Loch fällt, wird er oft als wehleidig oder verwöhnt abgetan. Obwohl das Phänomen massenhaft in Liedern, Theaterstücken, Filmen und Büchern (der "Werther" ist doch eigentlich auch nichts Anderes als eine sehr tragisch endende Quarterlife-Crisis) behandelt wird, dauerte es lange, bis es gesellschaftsfähig wurde.
Dass die Probleme der jungen Menschen zu selten ernstgenommen wurden, ärgerte Alexandra Robbins und Abby Wilner. Die beiden Amerikanerinnen steckten auch mitten in einer Phase, die ihnen niemand so richtig erklären konnte. Also taten sie es selbst: Mit ihrem Buch "Quarterlife-Crisis – die Sinnkrise der Mittzwanziger" (2001) prägten sie den Begriff. "Der erste Schritt, mit einer Quarterlife-Crisis fertig zu werden, besteht darin, zu erkennen, dass es sie gibt", schreiben Robbins und Wilner.
Zu oft fühlten sie sich mit ihren Fragen nicht ernstgenommen. Nach der ersten Auflage ihres Buches erhielten sie Zuschriften aus der ganzen Welt, von denen viele den gleichen Tenor hatten: "Ich dachte, ich wäre allein." Ihre Generation gelte gemeinhin als sorgenfrei, aber: "Früher musste man raus ins Leben und die Sache irgendwie regeln. Heute ist das anders. Es gibt keinen klar vorgezeichneten Weg und der Stress wird größer."
Ende 20 – die schlimmste Zeit des Lebens
Das belegen auch aktuelle Studien. Das Durchschnittsalter von Depressiven ist aus den späten Vierzigern in die Mitte der Zwanziger gerutscht. Eine Untersuchung des "Harvard Business Review" zeigt zwar, dass das Stresslevel laut einer Umfrage unter 88.000 Menschen aus dem Jahr 2015 auch in den Dreißigern und Vierzigern noch kontinuierlich ansteigt. Aber: Nie muss der Mensch mit einem so plötzlichen Anstieg an Stress zurechtkommen wie in den späten Zwanzigern. Die Wissenschaftler brechen ihre Studie auf eine Erkenntnis herunter, die wir vielleicht schon immer geahnt haben: "Die späten Zwanziger sind die schlimmste Zeit deines Lebens."
Dann nämlich entsteht ein diffuser Emotionsmix aus dem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität auf der einen Seite und der Frage "Soll das alles sein?" auf der anderen. Die einen wollen endlich irgendwo ankommen, die anderen wollen, dass mal wieder etwas passiert im Leben.
Die Flut von Möglichkeiten, die den "Fomo" (Fear of missing out), ein weiteres modernes Phänomen unter den Zwanzigern, hervorgebracht hat, wird sehr schnell zur Überforderung. Denn je mehr Optionen zur Wahl stehen, desto größer ist schon rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, die falsche zu wählen.
Doch noch einmal studieren? Auf einen neuen Beruf umsatteln, so lange es nicht zu spät ist? Die große Reise in Angriff nehmen, bevor auf einmal Kinder da sind? Raus aus der WG und eine eigene Wohnung suchen?
Die fünf Phasen der Krise
Der britische Forscher Oliver Robinson nennt Unsicherheit, Depression, Enttäuschung und Einsamkeit als hauptsächliche Kennzeichen der Krise. Besonders häufig sind Menschen betroffen, die entweder sehr großen Karriereehrgeiz haben oder hohe moralische Ansprüche an sich selbst stellen. Ihr Scheitern sei oft schon programmiert. Auch Menschen, die dazu neigen, sich viel mit anderen zu vergleichen, erwischt es meist besonders stark. Sie ärgern sich, wenn andere in ihrem Alter Haus, Partner und Traumjob haben, sie selbst aber nicht wissen, wie lange man ein Ei kochen muss. Viele fühlen sich unter Druck gesetzt, sei es von anderen oder von sich selbst: 40 Prozent der Befragten in Robinsons Studie hatten Geldsorgen, 32 Prozent litten unter der Erwartung (oder dem Wunsch), mit 30 verheiratet zu sein und Kinder zu haben. 21 Prozent der Befragten waren so unglücklich mit ihrem Beruf, dass sie in eine andere Branche wechseln wollten.
Robinson hat fünf Phasen der Quarterlife-Crisis identifiziert: Die erste Phase ist von einer großen Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben geprägt. Es folgt das Verlangen nach einer Veränderung sowie in Phase drei das Umsetzen: zum Beispiel den Job zu kündigen oder eine Beziehung zu beenden. In der vierten Phase erlangt man die Kontrolle über sein Leben zurück, bevor man wieder ganz in der Spur zurück ist und sich klarer auf seine Interessen und Werte konzentriert. So soll die Krise zur Chance werden.
Durchschnittlich, so hat eine Umfrage des Karrierenetzwerks LinkedIn ergeben, setzt die Quarterlife-Crisis um den 26. Geburtstag ein. Die Talsohle dauert dann meist etwa ein Jahr lang. Das muss aber nicht viel heißen: Der eine überwindet seine Sinnkrise scheinbar mit Leichtigkeit, der andere hängt jahrelang darin fest. Alles eine Frage des Typs und der Persönlichkeit, auch der Umstände. Psychologen raten dazu, für sich selbst klarzumachen, was einem wirklich wichtig ist, mit Freunden und Familie über die eigenen Probleme zu reden und auch mal den Mut zu fassen, aus den gesellschaftlichen Konventionen auszubrechen.
Die gute Nachricht ist also: Es geht vorbei. Die schlechte Nachricht ist: eigentlich auch nicht. Denn die Hoffnung, dass nach der überstandenen Krise ein Leben in Stabilität und Ausgeglichenheit vor uns liegt, ist trügerisch. Genauso wenig, wie nach den Wirren der Pubertät alle inneren und äußeren Unsicherheiten gelöst waren. Dass Fragen bleiben, und dass auch hinter jeder richtigen Antwort zwei neue Fragen lauern, gehört wahrscheinlich einfach zum Leben.
Vielleicht ist die Krise so etwas wie ein Dauerzustand. Und vielleicht ist sie dann auch gar nicht mehr so schlimm.