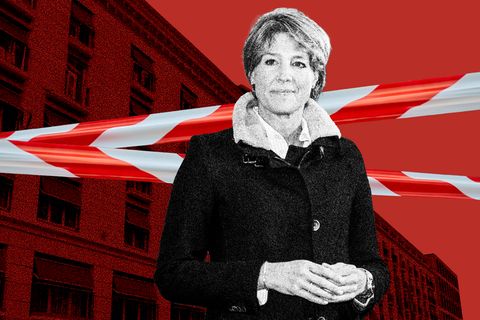Nach Einschätzung Australiens tragen die USA und nicht Wikileaks-Gründer Julian Assange die volle Verantwortung für die Veröffentlichung geheimer Diplomaten-Depeschen im Internet. Diejenigen, die ursprünglich die Weitergabe der rund 250.000 Nachrichten aus dem US-Außenministerium ermöglicht hätten, seien rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, sagte der australische Außenminister Kevin Rudd am Mittwoch. Die Tatsache, dass solche Nachrichten an die Öffentlichkeit gelangen konnten, stelle zudem die Sicherheit der Übertragungswege der USA infrage. "Herr Assange ist nicht selbst für die Veröffentlichung verantwortlich", sagte Rudd. "Die Amerikaner sind dafür verantwortlich."
Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange zeigt sich indes wenig dankbar. Er hat seine Enthüllungsplattform mit einem Artikel in der Tageszeitung "The Australian" verteidigt und sein Heimatland angegriffen. Wikileaks sei wichtiger denn je und Menschenleben seien mit der Veröffentlichung vertraulicher Dokumente nicht in Gefahr gebracht worden. Während Wikileaks vierjähriger Publikationsgeschichte seien ganze Regierungen verändert worden, aber keine einzige Person, soweit bekannt, verletzt worden, sagte Assange. Die USA hätten jedoch unter stillschweigendem Einverständnis Australiens allein in den vergangenen Monaten Tausende getötet, hieß es in dem Kommentar. Die Demokratie brauche wirkungsvolle und starke Medien, um ehrliche Regierungsführung zu ermöglichen. Dazu habe Wikileaks beigetragen.
Australien sicherte dem 39-Jährigen zudem Unterstützung zu. Assange werde "wie allen australischen Bürgern" konsularischer Beistand geleistet, sagte Rudd im australischen Fernsehen.
Schweden hatte Assange wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung von zwei Frauen international zur Fahndung ausschreiben lassen. Am Dienstagmorgen stellte sich Assange in London der Polizei. Er erklärte dem Richter im Amtsgericht von Westminster, dass er seine Auslieferung von Großbritannien nach Schweden anfechte. Seinem britischen Anwalt Mark Stephens zufolge gehen die Vorwürfe auf einen "Streit über einvernehmlichen, aber ungeschützten Geschlechtsverkehr" zurück.
Unterschlupf bei Journalisten
Während seiner Zeit in Großbritannien hatte Assange offenbar zwei Monate Unterschlupf in dem Londoner Journalistenclub Frontline gefunden, bevor er mit einer Frau zusammenzog. "Die meiste Zeit hat er sich hier im Frontline Club aufgehalten", sagte der Gründer des Medienclubs, Vaughan Smith. Er bezog sich damit auf die vergangenen Monate, wollte jedoch keine genaue Zeitspanne nennen, in der sich der 39-jährige Australier in der Einrichtung in London aufhielt.
"Er kam zu uns", sagte Smith weiter, "vor allem weil wir unabhängig sind und er den Club als einen sicheren Ort betrachtete". Der Frontline Club sei für Assange auch ein Ort gewesen, an dem er habe arbeiten und sich mit anderen Journalisten austauschen können. Assange hatte sich am Dienstag in London der Polizei gestellt und war daraufhin verhaftet worden. Smith versprach, Assange weiter zu unterstützen. "Ich bin misstrauisch, was die Vorwürfe gegen Herrn Assange angeht, und hoffe, dass dies vor Gericht einwandfrei geregelt wird", sagte Smith. Fast alle der etwa 1500 Mitglieder des Frontline-Clubs stünden hinter Assange.
Wikileaks wird der Geldhahn abgedreht
Unterdessen stellte der Kreditkartenkonzern Visa alle Zahlungen an Wikileaks ein. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben zunächst prüfen, "ob die Tätigkeit von Wikileaks den Geschäftsbedingungen von Visa zuwiderläuft". Visa habe die Entscheidung ohne "jeglichen Druck einer Regierung" getroffen. Damit folgte das Unternehmen dem Schritt des Konkurrenten Mastercard, der ebenfalls alle Kreditkartenzahlungen an Wikileaks einstellte. Mastercard berief sich auf einen Passus seiner Geschäftsbedingungen, wonach alle Kunden gesperrt würden, die "illegale Handlungen direkt oder indirekt unterstützen oder erleichtern".