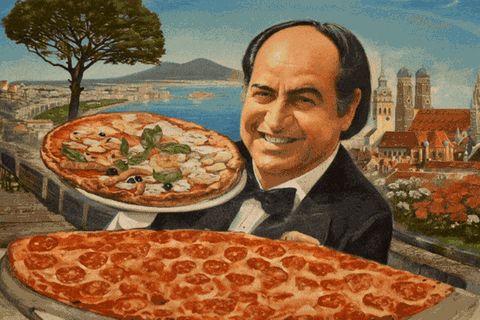Mit einem großen Medienaufgebot hat am Montag der Prozess um die Feuerkatastrophe im Montblanc-Tunnel vor fast sechs Jahren begonnen. 39 Menschen starben, als am 24. März 1999 ein Lastwagen mitten in dem Tunnel zwischen Frankreich und Italien in Brand geriet.
Technische Detailfragen dürften das Gericht wochenlang beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen Sicherheitsaspekte: Die letzte Feuerwehrübung im Tunnel fand in den 70er Jahren statt, das Material der französischen und italienischen Feuerwehr passte nicht zusammen. Hinzu kamen fatale Fehlentscheidungen. Von italienischer Seite wurde - statt Rauch abzusaugen - Frischluft zugefügt, was den Brand noch anfachte. Hitze und Rauch hinderten die Feuerwehr lange daran, zum Unglücksort vorzudringen. Die Temperaturen im Tunnel erreichten 1000 Grad. Erst nach drei Tagen erreichten Helfer den Brandherd.
Insgesamt 16 Einzelpersonen und Unternehmen sind der fahrlässigen Tötung angeklagt. Unter ihnen ist auch der belgische Fahrer des mit Margarine und Mehl beladenen Lastwagens, der in dem elf Kilometer langen Tunnel auf halber Strecke in Flammen aufgegangen war. Zu den beschuldigten Firmen zählen die beiden Betreibergesellschaften des Tunnels, die französische ATMB und die italienische SITMB, sowie der schwedische Autokonzern Volvo, von dem der Lastwagen stammte.
"Krieg der Experten"
Volvo hat jede Verantwortung für das Unglück zurückgewiesen, während die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass durch einen Konstruktionsfehler des Motors Öl auslief und den Brand auslöste. Die italienischen Tunnelbetreiber haben kurz vor Prozessbeginn 13,5 Millionen Euro in einen Fonds für die Angehörigen der Opfer eingezahlt, betrachten dies allerdings nicht als Schuldeingeständnis. Nach Umbauten für 300 Millionen Euro war der Haupttunnel zwischen Frankreich und Italien im März 2002 gegen den Protest der Bevölkerung wieder eröffnet worden.
Die Staatsanwaltschaft kritisiert außerdem mangelnde Sicherheitsmaßnahmen im Tunnel, in dem jahrelang keine Rettungsübungen veranstaltet worden seien. In der Verhandlung sollen 20 Sachverständige und mehr als 150 Zeugen aussagen, unter ihnen der frühere französische Ministerpräsident Edouard Balladur. Außerdem treten über 200 Nebenkläger aus Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Kroatien, Slowenien und Belgien in dem Verfahren auf. Beobachter befürchten einen "Krieg der Experten", denn bislang hat sich keiner der Beschuldigten auch nur zu einer Teilschuld bekannt. Mit einem Urteil wird in drei Monaten gerechnet.
"Die Verwandten der Opfer warten auf eine Konfrontation mit denjenigen, die sie als die Ursache ihres Unglückes betrachten. Was sie erlebt haben, ist schrecklich. Sie wollen die Gesichter zu den Namen kennen lernen", sagte der Nebenklage-Anwalt Alain Jakubowicz vor dem Prozess-Auftakt. Die Familien würden während der gesamten Dauer des Verfahrens psychologisch betreut. "Die Frage ist: Wo beginnt und wo endet die Kette der Verantwortlichkeiten?", sagte der Anwalt, der 32 der 39 Opfer-Familien vertritt. "Das Unglück war durchaus nicht unabwendbar, dies haben die Ermittlungsergebnisse der vergangenen fünf Jahre bewiesen." Jakubowicz bezog sich bei dieser Aussage auf ein Gutachten, wonach ein frühzeitiger Alarm den Verlust von Menschenleben verhindert hätte. Wären die Ampeln beim ersten Anzeichen einer Rauchentwicklung auf Rot geschaltet worden, hätte es keine Opfer gegeben, hieß es darin.