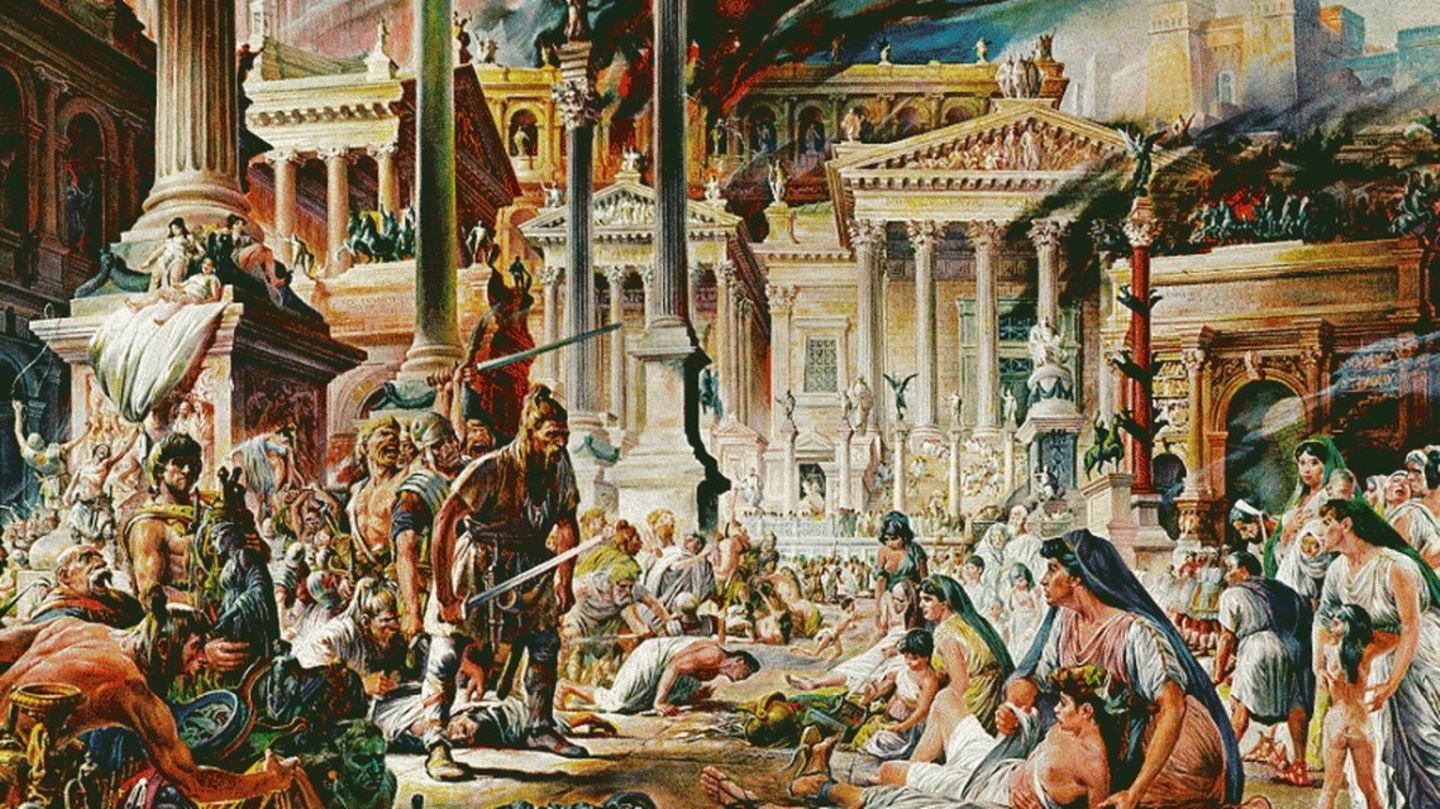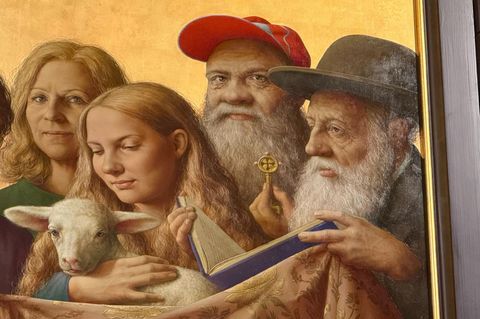Egal ob das Pantheon oder das Kolloseum: Noch immer sind eine große Zahl von Bauwerken aus dem Römischen Reich zumindest teilweise intakt. Obwohl sie teilweise schon knapp 2000 Jahre auf dem Buckel haben, sind sie noch immer erstaunlich stabil. Der legendäre römische Beton hält sie noch immer zusammen. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, was das Geheimnis des "opus caementitium" ist: Er flickt sich selbst.
Rom: Wissenschaftler lüften Geheimnis des legendären antiken Betons
Wie unter anderem die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, wollen US-amerikanische Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) die besondere Zutat gefunden haben: Kleine Kalkklumpen könnten römischen Beton und Mörtel so stabil machen und könnten sogar für Selbstheilungskräfte sorgen.
Bilden sich Risse im Beton, durch die Wasser rinnt, so entstehen kalkhaltige Mineralien, die die Hohlräume wieder auffüllen. Ein Beton, der sich selbst flickt.
Die Bestandteile römischen Betons sind Forschern schon seit längerer Zeit bekannt. Immer wieder untersuchten verschiedene Teams die Substanz. Darin fanden sie unter anderem vulkanische Asche und Gesteine und Meerwasser. Inhaltsstoffe, die ohnehin durch chemische Reaktionen die Haltbarkeit der Masse steigern. Auch die kleinen Klumpen aus Kalkstein fanden die Wissenschaftler. Aber sie taten sie jahrelang als Verunreinigungen ab – offenbar ein Fehler.
Alles andere als Verunreinigungen: Kalkklümpchen hatten wichtige Funktion
"Seit ich anfing, mit antikem römischem Beton zu arbeiten, war ich immer fasziniert von diesen Bestandteilen", erklärte Admir Masic, der Leiter der Forschungsgruppe, die nun die wahre Bedeutung des Kalksteins im römischen Beton erkannt haben könnte. Die Vorstellung, dass das Vorhandensein der Kalkklümpchen nur auf mangelhafte Qualitätskontrolle zurückzuführen sei, habe ihn immer gestört, erklärte das MIT in einer Pressemitteilung.
Die Wissenschaftler hätten deshalb genauer geprüft, ob der Kalkstein nicht doch eine bestimmte Funktion in dem Betongemisch habe. Um dies herauszufinden, untersuchten sie Mörtel von Mauern des antiken Ortes Privernum bei der heutigen Stadt Priverno südöstlich von Rom.
Dabei stellten sie fest, dass der antike Beton aus Sand, Vulkanasche, Bröckchen vulkanischen Gesteins, Wasser und Klümpchen aus ungelöschtem Kalk besteht. In einigen Fälle habe man auch gelöschter Kalk gefunden.
Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, entstehe durch die Reaktion von Wassers mit der Oberfläche des ungelöschten Kalks (Kalziumoxid) gelöschter Kalk (Kalziumhydroxid), was mit einer Wärmeentwicklung von bis zu 60 Grad Celsius einhergehe.
Der gelöschte Kalk wiederum reagiere mit Wasser und Sand zu einem zementartigen Bindemittel, wodurch noch mehr Wärme freigesetzt werde. Die Wissenschaftler nennen dies "Hot Mixing". Durch die Reaktionen werden zum einen die Gesteinsbröckchen fester in die Zementmatrix eingebunden. Zum anderen würden die Aushärte- und Abbindezeiten erheblich verkürzt, so Masic.
Römischer Beton konnte in Versuch innerhalb von 30 Tagen Riss auffüllen
Die Forscher rührten Betonmischungen mit und ohne Kalkklümpchen an und verglichen sie in Versuchen. Dabei ließen sie beide Mischungen aushärten, spalteten sie und fügten sie so zusammen, dass ein 0,5 Millimeter breiter Riss blieb. Anschließend übergossen sie beide Versuchsaufbauten mit Wasser.
Das Ergebnis: Während bei dem Beton ohne Kalkklümpchen auch nach 30 Tagen das Wasser fast ungehindert doch den Spalt floss, war der Spalt bei dem Beton mit enthaltenem Kalk nahezu dicht.
Grund hierfür sei, dass durch den Riss auch die Kalkbrocken gespalten habe. Der ungelöschte Kalk habe mit dem Wasser zu gelöschtem Kalk reagiert, sich mineralisiert und so den Spalt gefüllt. So spannend die Erkenntnisse auch sind, um das historische "Rezept" des römischen Betons zu verstehen, so praktisch könnten sie auch für die heutige Zeit werden, so die Wissenschaftler. Denn die Rezeptur könne auch die Haltbarkeit von 3D-gedrucktem Beton verbessern, so Masic.
Quellen: Süddeutsche Zeitung, Science Advances