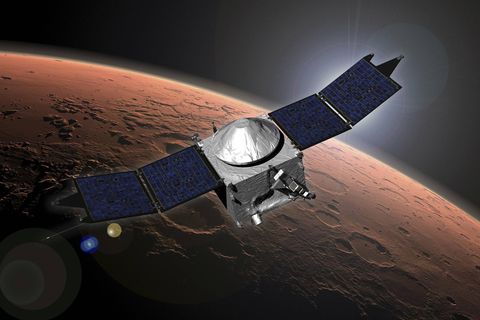"Ein automatischer Transport von Mars-Material zur Erde ist sehr kompliziert", sagt Jean-Pierre Lebreton vom europäischen Weltraumforschungszentrum Estec im niederländischen Nordwijk. "Eine Probenrückführung vom Mars wäre die komplexeste robotische Mission, die die Welt jemals in Angriff genommen hat", meint auch Scott Hubbard. Der ehemalige Chef des Mars-Programms der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat heute den Carl-Sagan-Lehrstuhl am Seti-Institut in Kalifornien inne. Eine "ganz schöne Herausforderung" sei eine "Mars Sample Return"-Mission, da sie ein völlig neues Konzept erfordere, bestätigt Doug McCuistion, der heutige Direktor des Mars-Explorations-Programms bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde.
Wenn sich Nasa und Esa gegenseitig versichern, wie schwierig eine solche Mission ist - was läge näher, als sie vereint in Angriff zu nehmen. "Europa und Amerika haben in den letzten Monaten Studien durchgeführt, wie eine solche gemeinsame Mission aussehen könnte", erklärt Jean-Pierre Lebreton vom Estec. "Sehr wahrscheinlich werden wir sie als internationale Kooperation durchführen."
Verschoben auf Sankt Nimmerlein?
"Imars" nennt sich die Arbeitsgruppe, die das Design einer trans-atlantischen "Mars Sample Return"-Mission entworfen hat. Die Esa hatte ursprünglich im Rahmen ihres Aurora-Mars-Programms eine eigenständige Probenrückführung geplant, die Nasa eine für das Jahr 2016, die sie nun aber vorerst abgesagt hat. "Wenn in den letzten fünf Jahren die entsprechenden Investitionen getätigt worden wären oder wir zumindest jetzt damit beginnen würden, wäre ein Starttermin 2016 noch zu halten", klagt Scott Hubbard. Da aber auch die Esa viele Jahre voraus plane und beide Raumfahrtbehörden ihre Zeitpläne aufeinander abstimmen müssten, dürfte die Mission wohl nicht vor 2020 startklar sein.
Einer der Gründe, warum Nasa und Esa die Vorbereitungen einer solchen Mission über so viele Jahre strecken, hat mit den Etats der Raumfahrtbehörden zu tun. Über mehrere Jahre verteilt fallen jeweils niedrigere Kosten an, als solch ein Unternehmen auf einen Schlag verschlingen würde. Auch muss die Technologie einer Probenrückführung erst noch entwickelt werden. "Die meisten Missionen fliegen zum Mars und bleiben auch da", so Doug McCuistion von der Nasa. Eine "Mars Sample Return"-Mission jedoch fliege nicht nur hin, um vor Ort zu bleiben, sondern sie brauche auch ein Startfahrzeug, das von der Oberfläche eines anderen Planeten wieder abheben kann. "So etwas haben wir noch nie gemacht", warnt der Nasa-Manager. Die Aufstiegskapsel muss ihre Gesteinsprobe in der Mars-Umlaufbahn an ein anderes Raumschiff übergeben, das dann damit zurück zur Erde fliegt und hier einen Wiedereintritt durch die Atmosphäre durchführt. "Wir haben also eine Landung auf dem Mars und am Ende eine auf der Erde - das sind eigentlich zwei oder drei Missionen in einer."
Was passiert, wenn ein Missionsteil scheitert?
Funktioniert ein Element im Missionsszenario nicht nach Plan, ist das ganze Projekt gescheitert. Aus diesem Grunde schlägt die Nasa vor, es auf zwei oder drei einzelne Missionen und damit Raketenstarts zu verteilen, zwischen denen mehrere Jahre vergehen könnten, wie Scott Hubbard beschreibt. "Zuerst könnten wir einen Orbiter starten, der in der Mars-Umlaufbahn geparkt wird und der später das Gestein zurück zur Erde fliegt." Sobald dieser erfolgreich einen Park-Orbit um Mars erreicht habe, könne ein Rover auf die Reise gehen, der vor Ort Proben entnimmt. Der dritte Bestandteil wäre eine Wiederaufstiegsrakete vom Mars Richtung Umlaufbahn. In sie würde der Rover die Bodenproben deponieren, mit denen sie dann Richtung Orbiter in der Umlaufbahn startet. Der Orbiter würde mit dem Mars-Material zurück zur Erde fliegen. Sollte ein Teil ausfallen oder scheitern, könnten Nasa und Esa ein zweites, baugleiches Raumschiff, einen Rover oder eine Rakete hinterherschicken, um die Mars Sample Return Mission insgesamt zu retten. Nur in Angriff genommen werden sie muss sie nun noch, denn sonst sind womöglich die ersten Menschen vor den nächsten Robotern vor Ort.