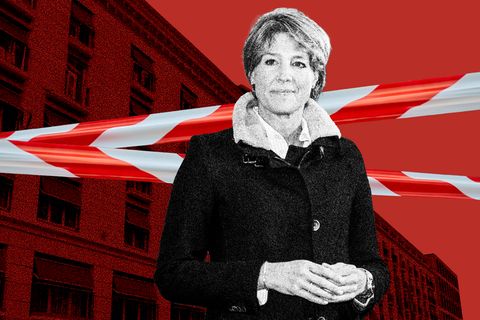Die Reise zur Sonne begann auf der Erde - und zwar am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau. Dort, im Erdgeschoss des Gebäudes, wirft Harald Krüger eine Maschine an, die prompt ohrenbetäubenden Lärm verursacht: "Wir stehen hier neben einer Vakuumpumpe", sagt der Wissenschaftler. Mit ihrer Hilfe testen Astronomen Instrumente unter den Druck- und Temperaturbedingungen des freien Weltraums. Solchen Tests wurden auch die Ulysses-Instrumente unterzogen, die vom MPI in Katlenburg-Lindau gebaut wurden. Harald Krüger ist einer der deutschen Forscher, die am amerikanisch-europäischen Gemeinschaftsprojekt Ulysses mitgearbeitet haben. Drei seiner zehn Experimente wurden in der Vakuumkammer konstruiert und getestet.
"Ulysses war eine großartige Mission", sagt Joachim Woch vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Woch hat speziell die Experimente zum Sonnenwind betreut, "Swics" und "Swoops" genannt. "Mit 'Swics' und 'Swoops' haben wir gemessen, dass der Sonnenwindstrom ein sehr konstanter ist, der mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgestoßen wird." Das hatten Astronomen schon vorher vermutet, mithilfe von Ulysses konnten Woch und seine Kollegen es zum ersten Mal direkt messen. "Daraus haben wir Erkenntnisse über die Atmosphäre der Sonne erhalten", so der Astronom. "Es muss in den polaren Breiten völlig andere Mechanismen geben, um den Sonnenwind von der Sonne weg zu beschleunigen, als in Äquatornähe." Der Sonnenwind besteht aus hochenergetischen Teilchen, die die Sonne mit bis zu 800 Kilometern pro Sekunde verlassen.
Interstellare Teilchen gefangen
Ulysses brachte nicht nur Erkenntnisse über den Sonnenwind. Mit dem Experiment "Gas" spürte sie interstellare Teilchen auf. Diese fliegen aus den Tiefen des Alls ständig in unser Sonnensystem hinein. So existieren beispielsweise Wolken aus interstellarem Helium, die sich durch den Raum bewegen. Ulysses hat solche Teilchen mit einem Auffangbehälter an Bord der Sonde gesammelt und analysiert. "Wir haben festgestellt, dass dieses interstellare Gas mit etwa 25 Kilometern pro Sekunde in unser Sonnensystem hinein fliegt oder, anders ausgedrückt, unser Sonnensystem sich mit 25 Kilometern pro Sekunde durch den interstellaren Raum bewegt" - so die Bilanz von Norbert Krupp, ebenfalls vom MPI in Katlenburg-Lindau.
Ulysses hat die Sonne auf einer polaren Umlaufbahn umrundet, ist also in etwa 300 Millionen Kilometer über ihren Nord- und den Südpol geflogen, was jeweils sechs Jahre gedauert hat. Ihr Orbit war so langgestreckt, dass sie in der Zeit dazwischen bis zum Jupiter hinaus getragen wurde. "Mit Ulysses haben wir beim Vorbeiflug am Jupiter bereits 1992 Staubströme entdeckt", so Harald Krüger im Rückblick. Dabei handele es sich um Staubteilchen vom Jupiter-Mond Io, die etwa zehn Nanometer klein sind und damit noch winziger als die Partikel des Zigarettenrauchs. Diese Teilchen werden von den Vulkanfontänen auf Io in den Weltraum geschleudert, elektrisch aufgeladen und fliegen dann mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Sekunde von Jupiter weg.
Als Ulysses 2004 wieder am Jupiter vorbei flog, konnten die Wissenschaftler das Phänomen bestätigen. "Das war völlig unerwartet", sagt Harald Krüger über das Experiment "Dust". Die Forscher wiesen dabei erstmals nach, wie viel mikroskopisch-kleines Material von Io mit welchem Tempo wie weit in unser Sonnensystem geschleudert wird. Das Magnetfeld des Riesenplaneten Jupiter beschleunigt die Partikel so stark, dass sie sich bis zur Umlaufbahn des Nachbarplaneten Mars ausdehnen. "Es wäre interessant hier mit einem weiterentwickelten Messinstrument die genaue Zusammensetzung der Teilchen analysieren zu können, um dann besser zu verstehen, wie die Teilchen in den Vulkanfontänen gebildet werden", so Krüger. Daraus könnten Astronomen auch Rückschlüsse über die Zusammensetzung des Mondes Io selbst ziehen.
2015 startet die nächste Sonnensonde
Die Wünsche der Wissenschaftler haben sowohl die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa wie Europas Weltraumagentur Esa erhört: Die Nasa entwickelt derzeit die nächste Sonnensonde "Solar Probe", die 2015 starten und achtmal näher an unser Zentralgestirn heran fliegen soll als alle bisherigen Raumschiffe. Im gleichen Jahr will die Esa mit "Solo" auf die Reise gehen, eine Abkürzung für "Solar Orbiter". Damit möchten die Astronomen erstmals Beobachtung aus der Ferne parallel zu einer Probenentnahme vor Ort durchführen.
Für Ulysses nähert sich das Ende der Mission, denn der Sonde geht die Energie aus. Bislang erhielt das Raumschiff von der Größe eines Kleinwagens Strom durch die thermale Ausstrahlung eines Plutonium-Generators: Er setzt die beim Zerfall radioaktiver Isotope entstehende Wärme in elektrische Energie um. Doch die Strahlung wird schwächer, wie die Esa berichtet. Ohne Energie wird Ulysses erfrieren: Momentan ist die Sonde mehr als 400 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Wenn die Treibstoffleitungen nicht ausreichend beheizt werden, gefriert das Hydrazin, welches die Sonde antreibt, und der Kontakt zur Sonde wird abreißen, auch wenn Ulysses weiter die Sonne umkreisen wird. Bislang funktioniert Ulysses, und bis zu ihrem endgültigen Kältetod würden die Forscher - so Europas Projektmanager Richard Marsden - noch "jeden Tropfen Wissenschaft aus der Sonde herauspressen".