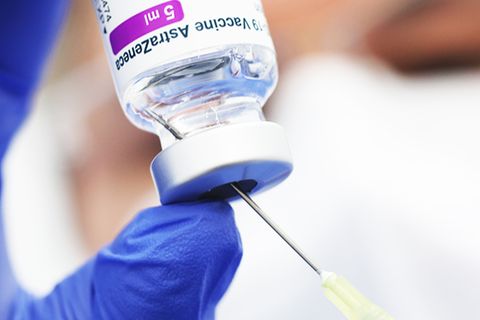Muschelkrebse sind eher unauffällige Wesen: Nur ein paar Millimeter groß werden sie, dazu tragen sie ein kalkhaltiges Gehäuse - wie Muscheln eben. Sie ernähren sich von Pflanzen, Schwebstoffen, Algen. Auffällig werden die Krebstiere allerdings, wenn es um die Fortpflanzung geht. Denn ihre Spermien sind bis zu zehnmal so lang wie die Tierchen selbst.
Die enorme Größe steht im Gegensatz zur verbreiteten Fortpflanzungsstrategie, bei der Männchen sehr viele, sehr kleine Spermien produzieren, die jeweils relativ wenig Energie kosten. Der Grund dafür: Muschelkrebs-Weibchen paaren sich mit mehreren Männchen und speichern deren Spermien bis zur Eiablage, bei der die Eier erst befruchtet werden. Nachdem also vor der Paarung die Männchen miteinander konkurrieren, tragen nach derselben ihre Spermien den Kampf weiter aus. Da scheint die Größe von Vorteil. Die Taktik kostet allerdings beide Geschlechter viel Energie: Die Fortpflanzungsorgane nehmen ein Drittel ihres Körpers ein.
Renate Matzke-Karasz von der LMU München und ihre Kollegen haben nun erforscht, wann sich diese Organe entwickelten. Sie untersuchten dafür Fossilien mit der so genannten Holotomografie. Sie ermöglicht einen Blick ins Innere der versteinerten Tierchen, ohne sie zu zerstören. "Bei den Ostrakoden konnten wir vor allem das Fortpflanzungssystem hervorragend darstellen - und stießen dabei auf eine große Überraschung", sagt Giles Miller vom Natural History Museum in London, der ebenfalls an der im Fachmagazin "Science" veröffentlichten Arbeit beteiligt war. "Unsere Resultate zeigen, dass sich auch diese 100 Millionen Jahre alten Ostrakoden aus der Kreidezeit schon mit Riesenspermien fortpflanzten.
Renate Matzke-Karasz ergänzt: "Die Riesenspermien sind zumindest in einigen Arten über lange Zeiträume hinweg produziert worden, obwohl sie für Männchen und Weibchen extrem kostspielig sind." Sie will nun erforschen, warum sich diese aufwändige Fortpflanzungstaktik bei den Muschelkrebsen seit so langer Zeit hält.