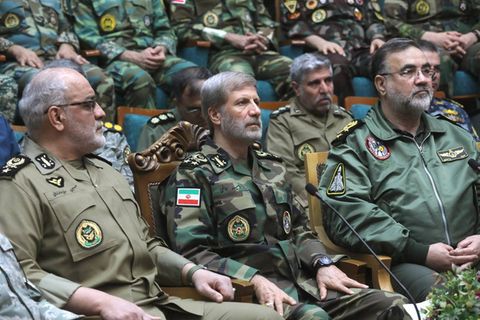Wollen Sie mal eine richtig lahme Maddie-McCann-Schlagzeile lesen? Wie wäre es damit: "Sensationelle Wende!" Lahm ist sie erstens, weil der "Fall Madeleine" eh so überfrachtet an vermeintlichen Wendungen ist, dass einem speiübel wird, wenn man allen Kurven folgen will. Und zweitens heißt "Wende" auch immer: Das, was wir gestern noch für eine Sensation hielten, hat sich heute als grober Unfug herausgestellt.
Ein Beispiel: Vor einigen Tagen titelte eine große deutsche Boulevardzeitung mit genau dieser Schlagzeile und schrieb, die portugiesischen Ermittler verfolgten auch die These, der seit vier Monaten verdächtigte Brite Robert Murat habe das Kind von einer Yacht ins Meer geworfen. So sensationell war die Wende im Erkenntnisstand der Ermittler allerdings nicht, die die Zeitung hier vermeldete. Eigentlich ist nur eines passiert: Am Tag zuvor hatte die portugiesische Tageszeitung "Diario de Noticias" mit einem Satz zwei Monate alte Gerüchte aufgekocht: Den Namen Robert Murat verwendete sie dabei genau einmal - ohne dass der Mann selbst ihr auch nur ein Bild wert wäre. Aber so brüllte das aufgewärmte Gerücht am nächsten Tag in Deutschland von den Kiosken.
Wenn Journalisten von Journalisten abschreiben
Bis vor Kurzem war der Weg einer deutschen Sensationsmeldung über die Fortschritte der Ermittlungen in der Regel sogar noch länger: Ein portugiesischer Journalist spricht mit irgendeinem Informanten aus der Polizei. Der steckt ihm etwas, das mal mehr oder mal weniger stimmt und am nächsten Tag in der portugiesischen Zeitung steht. Aus der lassen es sich dann die englischen Kollegen übersetzen und schreiben es am folgenden Tag in die englischen Zeitungen als News. Das lesen dann wiederum die Deutschen und schreiben es noch einen Tag später in ihre Zeitungen. In diesen zwei Tagen haben die Portugiesen natürlich schon zwei Mal etwas Neues (gerne auch komplett Entgegengesetztes) gesteckt bekommen, und so wendet und windet sich alles munter weiter. Vor lauter Kurven weiß man irgendwann nicht mehr, was sich alles schon gewendet hat, und was eigentlich noch beim Alten ist.
Zum Beispiel das Tagebuch von Kate McCann, das angeblich ein bedeutendes Beweismittel ist, und entweder beschlagnahmt oder als Kopie der Polizei und dem Richter vorliegt: Die ganze Geschichte wurde auch schon mal dementiert, und der portugiesische Journalist, der diese News als Erstes in die Welt setzte, ist etwas sauer auf seinen Informanten, weil der sich nun auch nicht mehr so ganz sicher ist, ob die Polizei das Tagebuch jetzt hat oder nicht. Die Tagebuch-Story wurde aber mittlerweile so oft geschrieben, dass keiner mehr weiß, ob es irgendwann einen neuen Informanten gab, der sie doch bestätigt hat, oder ob man einfach nur eine Ente weiter vor sich hinschmoren lässt. Jedenfalls wurden auch schon Details aus diesem Tagebuch geschildert.
Halbwahrheit werden als Fakten verkauft
Erschwert wird das Ganze dann noch durch bilaterale Schwierigkeiten. Dieselbe deutsche Boulevard-Zeitung mit der "sensationellen Wende" legt drei Tage drauf auf der ersten Seite nach: "Chefermittler schmeißt hin". Das hört sich an nach: "Polizei gibt auf!" Nur: Olegario Sousa, der Mann, der die Suche nach Madeleine angeblich "leitete", bekleidet zwar den Rang eines Chef-Inspektors, das heißt aber nicht, dass er der Chef des Ganzen ist, genauso wenig wie der Ober-Kommissar in Deutschland ein Kellner ist. Sousa ist einfach nur der Pressesprecher. Und das heißt in Portugal: Der Mann, der als Offizieller vorgeschickt wird, um den Journalisten nichts zu sagen.
Auch das ist eine weitere Schwierigkeit: Das portugiesische Recht verbat bis vor kurzem, dass Beteiligte sich zu Ermittlungen äußern. Dass dennoch geäußert wurde, war nicht nur eine Panne. Es war ein gezielt ausgetragener Kampf über die Medien: Mal sprach ein Polizist, mal ein Freund der McCanns; mal wurden die Eltern verdächtig gemacht, mal die Polizei kritisiert. Es war der Versuch, Meinung zu schaffen und Druck auf den jeweiligen Gegner zu erzeugen, egal, ob nun aus guten oder schlechten Motiven. Es war ein Kampf ohne Sieger: Die Polizei gilt nun als unglaubwürdig. Und die Eltern bis zur Klärung des Falls als irgendwie verdächtig.
Und es geht womöglich weiter: Heute taucht in der englischen "Sun" eine ungenannte Zeugin auf, die sagt, dass Kate McCann keineswegs den sehr verdächtigen Satz geschrieen hätte: "Sie haben sie geholt!" (War dann das Zitat der Tante von Madeleine, die im Telegraph genau diesen Ausruf schilderte, auch falsch?) Dieselbe Zeugin bringt auch gleich den Namen Robert Murat wieder ins Spiel: Ein Mann mit einem Kind im Arm sei in Richtung von Murats Haus gelaufen. Und so wird die Aufmerksamkeit wieder weg von den McCanns gelenkt.
Warum lesen Sie überhaupt noch darüber?
Die böse Journaille, (zu der zählen wir natürlich auch, sind wir doch möglicherweise selbst in manche Sackgasse gefolgt und davor auch in Zukunft nicht gefeit), spielt das Spiel natürlich gerne mit. Sie bestraft sich allerdings auch selbst. Zwei Tage lang holte sich vergangene Woche ein gutes Dutzend Reporter vor der Kirche einen Sonnenstich. Eine portugiesische Zeitung hatte "Quellen aus der Polizei" zitiert: Die Kirche in Praia da Luz werde durchsucht, denn seinerzeit hätten die Leichenspürhunde auch dort den "Geruch von Tod" entdeckt. Am dritten Tag kam die sensationelle Wendung. Wie verhießen "Quellen aus der Polizei": Die Kirche werde doch nicht durchsucht, denn, so erklären "Quellen aus der Kirche": Leichengeruch sei gar nicht so verdächtig an einem Ort, an dem regelmäßig Totenmessen abgehalten werden und der früher mal ein Friedhof war. Jetzt mag man natürlich die Frage stellen: Warum schreibt Ihr dann überhaupt noch darüber? Die Antwort ist die gleiche, wie auf die Frage: Warum lesen Sie überhaupt noch darüber?
Meinungen werden zu Meldungen
Auffallend ist, dass der so genannte "User Generated Content" in diesem Fall eine besonders große Rolle zu spielen scheint: Manche Zeitung hat schon auf Papier die anonymen Urteile ihrer Online-User veröffentlicht - und damit die Abfolge der vermeintlichen Wendungen noch einmal vorangetrieben. Man vermeldet ein paar sensationelle Wendungen, druckt die darauf folgenden noch sensationelleren Meinungen, die so zur Meldung werden und wiederum neue Meinungen bringen. Die Berichterstattung verselbstständigt sich, sie wird zum Perpetuum Mobile. Genau das birgt jedoch das Risiko, dass sie komplett aus der Bahn gerät, vor allem, wenn anonyme User angebliche Fakten in Foren stellen, die ihren Weg dann irgendwann ungeprüft auf Papier finden und so Wirklichkeit werden. Unabhängig davon, ob er je gelöst wird oder nicht: Der "Fall Madeleine" wird in die Geschichte eingehen. Und es kann gut sein, dass er das nicht als größtes Verbrechen tut. Oder weil er die beeindruckendste Mitgefühlswoge aller Zeiten über den Planeten rollen ließ. Er wird Geschichte schreiben als ein typischer Medienfall des globalisierten 21.Jahrhunderts, in dem der Versuch, Meinungen zu steuern, scheitert, weil die Öffentlichkeit schlicht zu groß geworden ist.