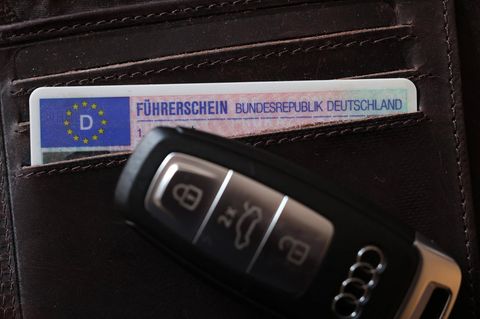Eine Müllhalde, aus der Rauch aufsteigt - das ist das erste, was von der Roma-Siedlung am Rande des Dorfes Plavecky Stvrtok zu sehen ist. Die Gemeinde räumt zwar alle zwei Jahre den ärgsten Müll weg, den die Bewohner am Rand deponieren. Toiletten oder Wasserleitungen gibt es aber nicht. "Dabei wäre es für unsere Kinder so wichtig, ein WC zu kennen, damit sie in der Schule nicht immer die einzigen sind, die damit nicht umgehen können", sagt einer der Roma.
Keine Arbeitsplätze für Roma
Eine geregelte Arbeit hat keiner hier. Kindergeld und Notstandshilfe sind die wichtigste Einnahmequelle. Um die Arbeitslosenunterstützung zu erhalten, müssen die Roma erwiesenermaßen auch arbeiten wollen: "Wir müssen zu Firmen gehen, die einen Arbeitsplatz ausgeschrieben haben. Aber wenn die Chefs sehen, dass wir Roma sind, sagen sie gleich, dass die Stelle nicht mehr frei ist", erzählt ein vierfacher Familienvater.
Trotz ihrer Armut sagen die Roma in Plavecky Stvrtok von sich: "Wir sind nicht so wie die Zigeuner im Osten, wir haben gemauerte Häuser." Was sie damit meinen, kann man im rund 400 Kilometer weiter östlich gelegenen Letanovce sehen: Bretterbuden aus Holz mit kaum wetterfesten Blechdächern, dazwischen Trampelpfade. Geht man um die Hütten herum, tritt man in Fäkalien.
Zitat
"Für unsere Kinder wäre es so wichtig, ein WC zu kennen, damit sie in der Schule nicht immer die einzigen sind, die damit nicht umgegehen können".
EU-Versprechen wurde nie gehalten
Dabei ist Letanovce eigentlich eine privilegierte Roma-Siedlung: Gemeinsam mit EU-Kommissar Günter Verheugen kamen im vergangenen Jahr Ministerpräsident Mikulas Dzurinda und andere Spitzenpolitiker des Landes hierher. Sie versprachen den Bau neuer, von der EU geförderter Wohnungen für die Slum-Bewohner. Es blieb bei dem Versprechen.
Rund 600 solcher ärmlichen Siedlungen gibt es in der Slowakei. In ihnen lebt rund die Hälfte der 300 000 bis 500 000 Roma, deren Bevölkerungsanteil auf sechs und neun Prozent geschätzt wird. Die slowakische Regierung verspricht EU-Vertretern mit Blick auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zum 1. Mai 2004 schon seit Jahren, intensiv nach Lösungen zu suchen. Die Praxis sieht meist anders aus. So nahm an einer internationalen Roma-Konferenz in Budapest im Juli der Kultusminister teil, während andere Staaten bei der Tagung durchweg mit ihrem Regierungschef vertreten waren.
Vorurteile und Diskriminierung
Auch der der ungarischen Minderheit in der Slowakei angehörende Vizepremier Pal Csaky, in der Regierung für die Minderheitenfrage zuständig, löste zuletzt nur Kopfschütteln aus: Als der Vorwurf laut wurde, in ostslowakischen Krankenhäusern seien Roma-Frauen zwangssterilisiert worden, kündigte er zunächst Klagen gegen die Urheber dieser angeblichen Falschmeldung an, ehe er auch eine Untersuchung der Vorwürfe in die Wege leitete.
Die Regierungsbeauftragte für Roma-Fragen, Klara Orgovanova, will unter solchen Umständen "kein Feigenblatt" sein, mit dem die Regierung Aktivitäten vortäuscht. Sie will auch nicht behaupten, dass die Sterilisationsvorwürfe stimmen. "Aber solche Fälle sind möglich, weil das gesellschaftliche Klima dafür besteht", sagt sie, und verlangt eine lückenlose Aufklärung. Zwangssterilisationen finden zwar keine Zustimmung in der Bevölkerung, aber "dass die Roma zu viele Kinder haben", ist in der Slowakei eine weit verbreitete Meinung. Orgovanova würde sich daher gerade von der politischen Elite eine klarere Haltung gegenüber Vorurteilen und Diskriminierung wünschen.
Roma-Frage hat keine politische Priorität
Dabei hätte die Slowakei Grund genug, der Roma-Frage politische Priorität zu geben: In keinem anderen Land ist der Roma-Anteil im Vergleich zur Gesamtbevölkerung so hoch. Und auf Grund der Geburtenrate steigt er rasch an, während die spärlichen, meist mit EU-Geldern geförderten Integrationsprojekte nur zögerlich greifen.
Vertreter der EU-Kommission wiederholten denn auch vor kurzem den Vorwurf mangelnder Fortschritte der Slowakei in der Verbesserung der Lebenssituation der Roma-Bevölkerung. Die slowakische Regierung zeige ganz im Gegensatz zu anderen Bereichen in der Roma-Frage nicht nur zu wenig Eigeninitiative, sondern nütze nicht einmal die vorhandenen Möglichkeiten der Projektfinanzierung.