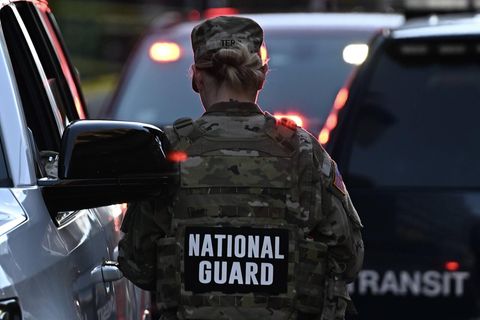Es ist ein stiller Flug, der an diesem 3. Juli um 23.26 Uhr in den Münchner Nachthimmel abhebt. Nur wenige wissen von ihm. Er steht in keinem Flugplan. Seine Passagiere haben fast kein Gepäck, einige nur das, was sie auf dem Leibe tragen. Keiner macht ein fröhliches Gesicht. Manche wirken wie betäubt. Der Flug erscheint nicht auf der Abflugtafel des Flughafens "Franz Josef Strauß". An Bord sind 134 Bundespolizisten, ein Arzt, ein Dolmetscher und 69 junge afghanische Männer. Sie sprechen nicht, das Reden ist ihnen verboten. Wenn sie zur Toilette müssen, begleitet sie ein Polizist bis zur Tür. Viele fliegen zum ersten Mal. Sie haben Angst. Ab und zu hört man unterdrücktes Weinen.
Noch weiß niemand, dass dieser Transit eine Woche später nationale Berühmtheit erlangen wird. In einer Pressekonferenz witzelt Bundesinnenminister Horst Seehofer, dass an seinem 69. Geburtstag genau 69 Afghanen abgeschoben wurden, so viele wie nie zuvor. Witzig findet das aber nur er selbst, selbst seinen Mitstreitern aus dem Innenministerium gefriert das Lächeln.
"Ich will nicht nach Afghanistan"
Über Wochen hat die Nation gebannt die Selbstzerfleischung der Union betrachtet, den bizarren Streit um Formulierungen, um Transit-, Transfer-, Ausschiffungszentren, um Grenzregime und Verwaltungsabkommen verfolgt. Ohne es zu wollen, lenkt Seehofer an diesem Tag mit seinem Verweis auf die 69 Afghanen den Blick auf das, worum es in der Flüchtlingskrise eigentlich geht: auf die Menschen.
Zu Nawid Ahmadi aus Unterelchingen im Landkreis Neu-Ulm kam die Polizei im Morgengrauen. An diesem Dienstag steht seine mündliche Prüfung für einen qualifizierenden Hauptschulabschluss an. Als der 24-Jährige begreift, dass er seine Prüfung nicht antreten wird, dass er überhaupt nie mehr eine Prüfung in Deutschland antreten wird, greift er verzweifelt zu einem Messer. Er schneidet sich in seine Unterarme und ist völlig außer sich. Die Polizisten bringen ihn ins Krankenhaus, er trägt nur Unterhose und Badelatschen. Im Hospital gibt man ihm Kleidung. Ahmadi verletzt sich später, festgesetzt auf der Polizeidienststelle, mit den Handschellen am Kopf und muss erneut ins Krankenhaus. Dann bringt man ihn zum Flughafen nach München.

Abdul Azim Sultani, 23, er wohnt im bayerischen Altenstadt, ist gerade auf dem Weg zur Arbeit im Altenheim, in dem er seit acht Monaten an zwei bis drei Tagen die Woche ein Praktikum macht, als mehrere Polizisten vor seiner Tür stehen. Erst glaubt er noch an einen Irrtum. Er hat einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag mit einem Seniorenheim, er freut sich auf den Hauptschulabschluss und die A2-Deutschprüfung, er hat einen Haufen Papiere und Dokumente. Er habe zehn Minuten, sagte man ihm. Sie ziehen sein Handy ein. Dann nehmen sie ihn mit. Er darf sich von niemandem verabschieden und verlässt Deutschland nach drei Jahren mit leeren Händen. Noch im Bus fleht Sultani um Gnade. "Ich will nicht nach Afghanistan", ruft er, "ich kenne dort niemanden, ich habe keinen Ort, wo ich hingehen könnte. Ich habe doch alles gemacht!"
Auf dem Flughafen in München treffen die Passagiere des Abschiebeflugs München–Kabul nach und nach ein. Einige warten schwer bewacht schon seit Stunden. 51 der 69 stammen aus Bayern. Schüler, angehende Azubis, Arbeiter, Suchende, Hoffende. Nur fünf dieser 51 sind Straftäter. 30 sind nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrates erst kurz vor der Abschiebung in ihren Wohnungen, Arbeitsstellen und Unterkünften verhaftet und zum Flughafen gebracht worden. Sie hatten nur wenige Minuten Zeit, zu packen oder wenigstens denen Lebewohl zu sagen, die sie in den vergangenen Jahren begleitet hatten.
Am Beginn eines neuen Lebens
Viele der Abgeschobenen waren fast die Hälfte ihres Lebens weg aus Afghanistan, manche waren jahrelang unterwegs, die meisten waren dabei, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Abdul Azim Sultani, der sich um alte Menschen kümmerte. Nawid Ahmadi, der an diesem Tag eine Prüfung ablegen wollte. Muhammed Gul Marof Khail, der schon seit dreieinhalb Jahren bei der Schweißtechnikfirma Burkhard in Kaufbeuren arbeitet. Esam M., angehender Lehrling der Konditorei Riedmair in München. Einer wurde aus einer Klinik abgeholt, in der er wegen Depressionen behandelt wurde, ein anderer, Sardar Vali Sadozai aus dem sächsischen Wurzen, aus der Wohnung seiner Freundin Ute. Er arbeitete zuletzt bei Aldi, davor in einem Möbelhaus und bei einem Postdienstleister. Die beiden wollten heiraten, aber die Beschaffung seiner Dokumente hatte sich gezogen.
"Der Besuch einer Schule oder ein Arbeitsplatz schützen nicht vor Abschiebung. Das ist geltendes Ausländerrecht", sagt Oliver Platzer, Sprecher des bayerischen Innenministeriums.

Es scheint, zumindest im Freistaat, offenbar noch ganz anders zu laufen: Der Besuch einer Schule, ein in Aussicht stehender Ausbildungsplatz oder das Bemühen um Arbeit verschärfen die Abschiebungsdringlichkeit. Im Abschiebehaftantrag der zentralen Ausländerbehörde Oberbayern für einen der Abgeschobenen stand nach Auskunft von Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat als Begründung, dass das Bemühen um eine Ausbildung ein klares Indiz dafür sei, dass der Betreffende nicht beabsichtige, freiwillig auszureisen.
In Markus Söders Bayern geht es nicht mehr um Integration, um Sprachkurse, um "wir schaffen das". Es geht um Zahlen. Zwar freute sich Horst Seehofer bei seiner vermaledeiten Pressekonferenz, dass an seinem Geburtstag mehr Menschen abgeschoben wurden als bisher. Was er nicht sagte: Insgesamt sind es deutlich weniger Abschiebungen als im vergangenen Jahr, was daran liegen dürfte, dass es da noch viele Balkanflüchtlinge gab, derer man sich leichter entledigen konnte.
Die Zahlen sind ein Problem. Vor der bayerischen Landtagswahl im Oktober muss im "Endspiel um die Glaubwürdigkeit" (Söder) jetzt abgeschoben werden. Schnell. Viel. Landauf, landab herrsche massiver Druck auf Behördenmitarbeiter, Leute zur Abschiebung fertig zu machen, hat Stephan Dünnwald vom Flüchtlingsrat in seinen Gesprächen mit Beamten der Ausländerbehörden erfahren. "Duldungen werden ungültig gestempelt, Arbeitserlaubnisse nicht erteilt, Haftgelegenheiten werden ausgebaut, und zwar sehr hektisch."
Ein kleiner Fisch
Aus anderen Bundesländern sollen an jenem 3. Juli vor allem islamistische Gefährder, Identitätsverweigerer und Straftäter zum Flughafen nach München gebracht worden sein. Jamal Naser Mahmodi, 23, zum Beispiel. Er lebte zuletzt in Hamburg. Ihn holt die Polizei in der Nacht in seiner Unterkunft ab. In einem Kleinbus wird er nach München gebracht, begleitet von einer Beamtin der Ausländerbehörde und einem Arzt. Er wehrt sich nicht, wirkt still und in sich gekehrt. Ja, er sei ein ausreisepflichtiger Straftäter, so sagt es ein Vertreter der Ausländerbehörde. Er war schwarzgefahren, hatte geklaut und einmal mit einer Wodkaflasche nach einem Mann geworfen. Aber nicht getroffen. Mahmodi war keine große Nummer. Kein Leibwächter Bin Ladens. Ein kleiner Fisch.
Sultani, Sadozai und die anderen sehen Mahmodi, aber sie sprechen nicht mit ihm. Sie haben genug eigene Sorgen. Der Hamburger sucht keinen Kontakt.
Mahmodi kam 2011 mit 16 Jahren als sogenannter unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland. Trotzdem scheint er nie richtig angekommen, anders als viele, die mit ihm im Flieger sitzen. Wer ihn in den Jahren betreut, gefördert, vertreten hat, ist wenig bekannt; warum er aufgegeben hat, auch. Er hatte einen Ausbildungsplatz, an dem er nach kurzer Zeit nicht mehr erschienen ist.

Kurz vor dem Abflug bekommen einige der "Schüblinge" ihre Telefone zurück. Ein letzter Anruf zu Hause. Abdul Azim Sultani ruft seinen Freund und Nachbarn Sven Güntner an. "Er ist für mich wie Familie", sagt Sultani später. "Er hat mir über Jahre geholfen, wir haben zusammen gelernt. Ich wollte weiterreisen, als mein Asylantrag abgelehnt wurde, aber Sven hat gesagt: 'Bleib hier, wir helfen dir. Es wird Winter sein, und du wirst wieder allein sein, wieder bei null anfangen, eine neue Sprache, ein neues Land. Behalte deinen Traum, in Deutschland eine Ausbildung zu machen.'"
Sultani blieb. Ihm war Deutschland lieb geworden, er sehnte sich nach Heimat. Seine Mutter starb, als er klein war, der Vater hatte die Familie verlassen, so erzählte er. Der Junge wuchs bei seiner Großmutter auf und half auf ihrem Hof. Mit 14 Jahren ging er in den Iran und verdiente sein Geld als Hilfsarbeiter in 16-Stunden-Tagen in einer Fabrik. Aber er träumte von Europa, von Deutschland, dort könnte es besser sein. 2015 kam er über Passau ins idyllische Altenstadt an der Iller. Wo er ein Teil des deutschen Sommermärchens wurde, in einem Städtchen, in dem bei der letzten Bundestagswahl knapp 38 Prozent der Menschen CSU wählten.
Um viele der nun Abgeschobenen haben sich in den vergangenen Jahren Freiwillige bemüht. Haben mit ihnen gekocht, ihnen Kleidung und die erste Wohnung organisiert, mit ihnen gelesen, gelernt, Gesetze, Kultur, deutsche Grammatik, ich bin, du bist, er ist.
Die Helfer fühlen sich betrogen
Es sind Hausfrauen, Angestellte, Richter, Handwerker, Lehrer. Viele von ihnen sind ältere Leute, die ein Berufsleben hinter sich haben. Einige sind praktizierende Christen, sie tragen den Satz "Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" in ihren Herzen. Es ist die Mitte Deutschlands. Sie haben das alles ernst genommen im Sommer 2015 und danach. Dass jetzt alle mit anfassen müssen, dass sie gebraucht werden, dass die Behörden es allein nicht schaffen.
Jetzt schlägt die Politik Haken. Die einst willkommenen Helfer werden zur "Anti-Abschiebe-Industrie", Integration ist kein Ziel mehr, sondern ein Indiz, dass jemand nicht ausreisen will. All die Gänge auf Ämter, das Lernen, die Anträge, die Vormundschaften, alle Anstrengungen, alles umsonst. Viele Helfer sind fassungslos. Sie fühlen sich missbraucht, betrogen, verarscht.
Sigrid Thelen, 61, ist Bibliothekarin, ihr Mann arbeitet bei der Bundeswehr. Sie hat sich um Nawid Ahmadi gekümmert. Sie ist es, die nun seine Hilferufe entgegennimmt, die er über das Handy eines Mitabgeschobenen absetzt. "Bitte mir helfen", schreibt er. "Ich habe niemanden. Ich kann nicht mehr. Ich habe viel Angst. Selbstmord ich denke." Ob das noch ihr Land ist? "Ich weiß es nicht mehr", sagt Sigrid Thelen. "In unserem Land ist so viel gut und in Ordnung. Aber ich habe viel Vertrauen verloren."

Zwei Wochen sind nun vergangen. Sven Güntner, 39, macht sich noch immer Vorwürfe. Er war nicht da, als sein Freund abgeführt wurde. Der Logistikleiter in einem Fotovoltaikunternehmen, der mit seiner Frau im restaurierten Bauernhaus in Altenstadt wohnt, hatte sich in den letzten Jahren um Abdul Azim Sultani gekümmert. Der wohnte nebenan, in einem Mehrfamilienhaus mit Stockbetten für geflüchtete Menschen. "Ich hätte mich dazwischengeworfen", sagt er. "Abdul hat laut meinen Namen gerufen und um Hilfe geschrien, das haben meine Nachbarn erzählt. Ich könnte heulen, auch wenn ich weiß, dass die Polizisten nur ihren Job machen. Aber warum ihn, hätte ich gefragt, warum reißt ihr ihn aus unserer Mitte?"
Der stern hat einige der 69 Abgeschobenen in Kabul getroffen. Sultani ist dabei, der angehende Pflegehelfer, und Sardar Vali Sadozai, der seine Ute heiraten wollte und auch noch Nachtschichten bei einem Transportunternehmen schob. Sie sehen müde aus. Sie wachen zu früh auf, sie schlafen zu spät ein. Es gäbe viel zu tun, wenn man von vorn anfangen will in einem Land wie Afghanistan, aber sie wissen nicht, wie. Sultani hat sich ein paar Schuhe leihen müssen und besitzt noch 50 Dollar. Bald müssen sie raus aus dem Hotel Spinzar, in dem sie für die ersten Tage unterkamen. Bloß wohin? "Nur Gott weiß, was mit uns geschieht", sagt Sultani. Die anderen sehen ihn an. Niemand weiß, welchen Gott er gerade meint. Ist aber auch egal.
Geworfen wie ein Päckchen
Sultanis afghanischen Bekannten, die noch in Deutschland sind, macht das alles Angst. Von den ehemals rund 30 Asylbewerbern in Güntners Nachbarschaft sind nur noch wenige da. Einige sind weitergereist, viele davon nach Frankreich, um einer Abschiebung zu entgehen. Sie leben in Slums oder unter freiem Himmel, sie sprechen kein Französisch, sondern bayerisches Deutsch. Man nennt sie dort: die Deutschen. Manchmal wissen sie selbst nicht mehr, was sie nun eigentlich sind.
"Immer mehr Flüchtlinge verstecken sich oder versuchen, in andere Länder zu fliehen", sagt Sigrid Thelen. "Die Leute kommen nicht mehr zum Unterricht. Viele von denen, um die wir uns gekümmert haben, sind bereits untergetaucht. Einer, das haben wir auch erfahren müssen, hat sich auf seiner Weiterflucht von Schwaben nach Frankreich das Leben genommen."

Thelen vermittelt dem stern eine Zeugin, die dabei war, als Nawid Ahmadi aus dem Krankenhaus mitgenommen wurde. "Diese Situation habe ich zufällig gesehen", schreibt diese. "Es wurde mit unglaublicher Härte vorgegangen: die Arme auf den Rücken, die Beine zusammengebunden, wurde er bäuchlings regelrecht in das Polizeiauto geworfen. Wie ein Päckchen. Der Umgang und die Härte haben mich sehr schockiert."
Thelens Mitstreiterin Birgit Möller, 63, eine Ärztin, sorgt sich wie viele andere in Elchingen, wie es nun weitergeht. "Bisher haben wir die Geflüchteten immer ermuntert, sich integrationswillig zu zeigen, ihr müsst lernen wie die Verrückten, haben wir gesagt, das wird euch später helfen. Aber das hat sich ja nun nicht bewahrheitet."
"Bruder in Christus"
Nawid Ahmadi ist inzwischen, wie die meisten des Geburtstagsfluges, aus dem Hotel Spinzar in Kabul verschwunden, mit unbekanntem Ziel. Es heißt, er sei Richtung iranische Grenze unterwegs zu einem fernen Onkel im Nachbarland.
In seiner Sonntagspredigt erzählt der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm von einem weiteren Flüchtling aus dem bisher größten Abschiebeflug nach Afghanistan. Ein junger Mann, dem das Bamf nicht geglaubt hat, dass er konvertiert ist. Der Theologe nennt ihn Ahrun, einen "Bruder in Christus", der "nach gründlicher Unterweisung in vielen Taufkursstunden getauft" worden sei. Ahrun ist nicht sein richtiger Name. Jetzt, in Afghanistan, darf niemand wissen, dass er sich hat taufen lassen.

"Ahrun ist nach acht Jahren in Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden", sagt der höchste evangelische Gottesmann. "Alle kirchlichen Bemühungen konnten es nicht verhindern." Ein Dekan hatte an seinem letzten Nachmittag in Deutschland noch mit Ahrun telefoniert. Aber er habe kaum sprechen können und sediert gewirkt. Ahrun suche jetzt nach Wegen zurückzukommen. Seine Gemeinde will ihm helfen. Vielleicht wagt er noch einmal den Weg übers Meer.
Schübling Nummer 69
Es war ein Tag, an dem einiges zusammenkam, dieser 4. Juli 2018, an dem der Abschiebeflug Nr. 14 um 8.40 Uhr Ortszeit auf der holprigen Landebahn der afghanischen Hauptstadt aufsetzte. Ein Tag, an dem wegen einer der häufigen Bombenwarnungen in Kabul kein Diplomat es zum Flughafen schaffte, wie es eigentlich vorgesehen ist. Horst Seehofer feierte seinen 69. Geburtstag. In Syrien scheiterten die Gespräche zwischen Rebellen, der Regierung und den Russen, was 330.000 geflohenen Männern, Frauen, Kindern den Rückweg in die Heimat abschneidet.
Und in Kabul erhängte sich, mutmaßlich schon am Ende dieser Nacht, mit 23 Jahren Schübling Nummer 69, Jamal Naser Mahmodi aus Hamburg, in seinem Hotelzimmer. Sein Leichnam wurde inzwischen in der Nähe von Masar-i-Scharif beerdigt, in dem Ort, aus dem seine Eltern ihn mit 15 auf die Reise schickten, dass er von den Taliban nicht rekrutiert werde und in Europa sein Glück fände.