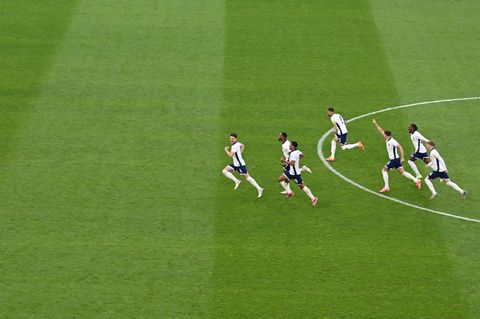Der 8. Februar 1849, jener Tag, an dem Dr. France Preseren 49-jährig an Leberzirrhose starb, wird in Slowenien alljährlich kräftig begossen. Den Todestag des Nationaldichters begeht die junge Republik als Kulturfeiertag. Natürlich wird dann auch die Nationalhymne angestimmt, die aus Preserens Feder stammt. Es ist die siebte Strophe eines Trinkliedes, das mit den Worten beginnt: "Ihr Freunde, hebt die Gläser ..." Der Sohn eines Landarbeiters, 1800 in der Nähe von Bled geboren, schaffte es, in Wien Jura zu studieren und auch zu promovieren.
Doch die juristische Karriere blieb ihm versagt. Er verweigerte sich dem Anpassungsdruck der besseren Gesellschaft, schrieb regimekritische Artikel. Auch die Anerkennung seines lyrischen Schaffens erlebte er nicht mehr, obwohl seine Verse neue Standards setzten. Vor ihm hatten die gebildeten Stände und die Städter deutsch gesprochen, Slowenisch war die Sprache der Bauern und Landpfarrer. Er war der erste Dichter, der das Potenzial der slowenischen Sprache ausschöpfte - und einer eigenständigen slowenischen Identität Ausdruck verlieh. Er wurde damit zum Nationalsymbol eines Volkes, das nie ein eigenes Staatsgebiet, nie einen eigenen König hatte und seit Jahrhunderten als Anhängsel verschiedener Mächte hin- und hergeschoben wurde.
Zeittafel
um 600 bis 400 v. Chr.: Besiedlung durch illyrische Stämme
1. Jh.: Eingliederung ins Römische Reich
7. Jh.: Stammesfürstentum Karantanien
8. Jh.: Eroberung durch Karl den Großen
1282: Slowenien wird Teil des Habsburger Reichs
1918: Proklamation des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen
1929: Slowenien wird Teil des Königreichs Jugoslawien
1945: Slowenien wird Teil der Republik Jugoslawien
1990: Abspaltung Sloweniens
25. 6. 1991: Unabhängigkeitserklärung
27. 6.-7. 7.: Siegreiche Kämpfe gegen die jugoslawische Bundesarmee
23. 12. 1991: Als erster Staat der damaligen EG erkennt Deutschland Slowenien an
15. 1. 1992: Anerkennung Sloweniens durch die EG
1998: Erste EU-Beitrittsverhandlungen
März 2003: Volksentscheid: 89,6 Prozent der Slowenen für EU-Beitritt
1848 demonstrierte er bei den Wiener Aufständen als Rekrut der Krajner Volkswehr gegen den österreichischen Vielvölkerstaat und brach mit seinen alten Freunden. Seine politischen Bande zu den liberalen Deutschen bedeuteten ihm weniger als die nationale Zugehörigkeit.
Aufruhr gegen die Zentralgewalt
Erst 1918 wurde Slowenisch zur Amts- und Staatssprache, blieb aber sowohl im königlichen als auch im sozialistischen Jugoslawien zweitrangig. Sprachliche Diskriminierung war schließlich einer der Auslöser für Sloweniens Separatismus. Als Belgrad 1988 slowenischen Dissidenten den Prozess machte, ging eine Welle der Empörung durch das Land, weil die Verhandlung auf Serbokroatisch geführt wurde. "Die Slowenen können keinen Staat als ihren akzeptieren, der ihnen nicht den Gebrauch der Muttersprache und deren Gleichberechtigung garantiert", so Milan Kucan, einst Chef der slowenischen Kommunisten und später Sloweniens erster demokratischer Präsident. Das war der erste Aufruhr gegen die Zentralgewalt.
Als Wegbereiter dieses Identitätsbewusstseins der Slowenen gilt France Preseren. Zum Verhängnis war ihm seine letzte Liebe geworden. Die Liebe zu einer Wirtstochter. Es ist verbürgt, dass er auch ihretwegen seit 1841 viel Zeit in der Schänke verbracht hatte. Preseren starb als verkrachte Existenz, alkoholkrank und verarmt. Heute ziert sein Konterfei die 1000-Tolar-Note der Slowenischen Bank.