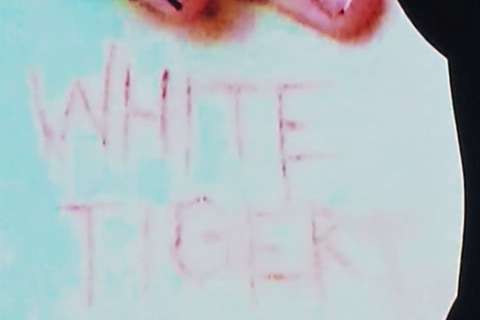A. Domkirche St. Marien: Katholizismus in Hamburg
Der Rundgang beginnt an der Kathedralkirche des Erzbistums Hamburg. Die ursprüngliche Kirche wurde durch den Heiligen Ansgar, einen Benediktinermönch, erbaut. Er kam 834 mit einem Missionierungsauftrag nach Norddeutschland und christianisierte die Völker des Nordens, trotz regelmäßiger Wikingerüberfälle.
Nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hatte, hielt die Reformation auch in Hamburg Einzug und die Stadt wurde protestantisch. Mit dem Erlass der Hamburger Kirchenordnung war die Feier öffentlicher katholischer Gottesdienste streng verboten, zudem wurde allen Nicht--Lutheranern das Bürgerrecht verweigert.
Die problematische Situation der Katholik*innen änderte sich nur langsam. Zunächst durften sie Ende des 18. Jahrhunderts ihren Glauben privat ausüben. Dann kamen mit den französischen Truppen unter Napoleon katholische Soldaten in die Stadt, und es wurden wieder katholische Gottesdienste gefeiert.
Info: Am Mariendom 7, www.mariendomhamburg.de
A. Das Franzbrötchen: Eine Mimikry der besonderen Art
Eine Stärkung für unterwegs bietet Hamburgs leckerster und zugleich sagenumwobener Snack, der in keiner Bäckerei fehlt. Die Herkunft des Franzbrötchens ist nämlich bis heute nicht geklärt – zwei Theorien gibt es trotzdem:
Theorie 1: Von 1806 bis 1814 hatten Napoleons Truppen Hamburg fest in ihrer Hand und zur Besetzung natürlich auch ihr leckeres Croissant mitgebracht. Auf das wollten die Hamburger*innen nach Abzug der Franzosen nicht verzichten: Der deutsche Versuch endete allerdings nicht in einem Croissant, sondern in einem Franzbrötchen – und das trägt sein französisches Vorbild noch heute im Namen.
Theorie 2: Im frühen 19. Jahrhundert übernahm Johann Hinrich Thielemann die Bäckerei eines Franzosen im Stadtteil Altona. Über die nächsten drei Generationen hinweg bezeichneten sich die Thielemanns als "franz’scher" Bäcker – und erfanden das dazu passende Franzbrötchen.
Ursprung hin oder her - Fakt ist: Das Franzbrötchen schmeckt verdammt lecker.
B. Hamburger Hafen: Das Tor zur Welt
Was wäre Hamburg ohne den Hafen? Einen tollen Ausblick auf Vergangenheit und Gegenwart hat man an den Landungsbrücken. Im 9. Jahrhundert wurde erstmals eine hölzerne Hafenanlage an einem Mündungsarm der Bille zur Alster erwähnt – als Teil einer Siedlung namens Hammaburg. Ende des 12. Jahrhunderts ließen die Grafen von Schauenburg und Holstein einen Hafen am heutigen Nikolaifleet errichten. Als Geburtstag des Hamburger Hafens gilt der 7. Mai 1189. Darauf ist ein Freibrief von Kaiser Friedrich I. Barbarossa datiert, der unter anderem zollfreie Fahrt auf der Unterelbe bis zur Nordsee gewährt. Heute weiß man: Das Dokument ist eine Fälschung aus dem 13. Jahrhundert.
Irgendwann wurde das Nikolaifleet zu klein für die immer größer werdenden Schiffe. 1863 begann der Bau des Hafenbeckens am Sandtorkai. Als Hamburg sich 1881 dem Deutschen Zollgebiet anschloss, tauchte jedoch ein Problem auf: Die Zollfreiheit galt nun nur noch im Freihafen. Deshalb wurde dort ein Lagerhauskomplex errichtet, die heutige Speicherstadt. Auf dem Gelände lebten damals aber vor allem Hafenarbeiter*innen. Die Wohnungen wurden abgerissen, 24.000 Menschen mussten umziehen.
Info: Bei den St. Pauli Landungsbrücken
C. Gängeviertel: Gassen des Elends
Viele der Hafenarbeiter*innen zog es in die Gängeviertel im Stadtinnern, von denen im Bäckerbreitergang -- unweit des Gänsemarktes -- noch heute Spuren zu sehen sind. Was jetzt malerisch wirkt, war im 19. Jahrhundert alles andere als angenehm. Familien drängten sich in die kleinen Fachwerkhäuser und engen Gassen, in denen seit dem 17. Jahrhundert die arme Stadtbevölkerung lebte. Heute würde man wohl von einem Slum sprechen.
Über mehrere Areale in der Alt- und Neustadt verteilt, lebten die Menschen dicht gedrängt in sogenannten "Buden" unter schlimmsten hygienischen Bedingungen. Da verwundert es nicht, dass im Sommer 1892 in den Gängevierteln die Cholera ausbrach. Hauptursache dafür war das dreckige Wasser aus den Fleeten, das die Bewohner*innen als Trinkwasser verwendeten. Die Stadt Hamburg ergriff aber nur zögerlich Maßnahmen gegen die Epidemie.
Als langfristige Folge dieses letzten großen Choleraausbruchs in Deutschland wurden die Gängeviertel nach und nach saniert oder abgerissen.
Info: Bäckerbreitergang