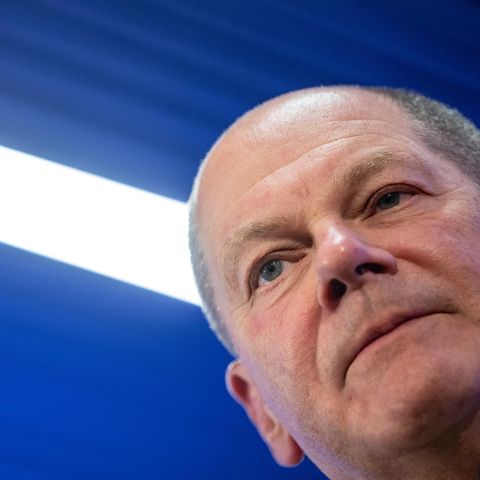Das Defizit im deutschen Staatshaushalt ist im vergangenen Jahr größer ausgefallen als bislang angenommen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 87,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Eine erste Schätzung im Januar hatte nur ein Minus von 82,7 Milliarden Euro ergeben. Das neue Ergebnis entspricht einer Defizitquote von 2,1 (bisher: 2,0) Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die damit erneut unter der EU-Obergrenze von drei Prozent blieb.
"Das Defizit blieb damit hoch", betonten die Statistiker. Es fiel allerdings um 9,5 Milliarden Euro geringer aus als 2022. Grund dafür sei, dass die Einnahmen des Staats mit 4,4 Prozent auf 1901,8 Milliarden Euro stärker gestiegen seien als die Ausgaben mit 3,7 Prozent auf 1989,2 Milliarden Euro. Insgesamt waren die Ausgaben demnach also höher als die Einnahmen. Das Statistikamt errechnete für 2023 eine Defizitquote von 2,1 Prozent – 0,1 Prozentpunkte mehr als nach der ersten vorläufigen Berechnung vom Januar.
Bund verzeichnet höhere Sozialausgaben
Wegen der Rekordbeschäftigung nahmen die Sozialbeiträge um 6,6 Prozent zu. Die Steuereinnahmen wuchsen dagegen lediglich um 0,7 Prozent. "Dies lag neben der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch an umfangreichen Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft", hieß es. Hierzu zählten unter anderem Entlastungen in Form des Inflationsausgleichsgesetzes, Inflationsausgleichsprämien, der Senkung des Umsatzsteuersatzes bei Gas von 19 auf sieben Prozent und der Verlängerung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bei Speisen in der Gastronomie bis Ende 2023. Wegen Mehrausgaben beim neu eingeführten Bürgergeld und der gesetzlichen Rente hätten diese im Vergleich zu 2022 um 6,8 Prozent zugenommen.
Bundesfinanzminister Christian Lindner plädiert angesichts der konjunkturellen Schwäche dafür, drei Jahre lang keine neuen Sozialleistungen einzuführen. Es sei quasi ein Volkssport gewesen, ständig neue Subventionen und höhere soziale Leistungen zu beschließen. "Damit müssen wir einmal drei Jahre auskommen", sagte der FDP-Chef am Freitag im belgischen Gent. Es gebe regelmäßige Erhöhungen dieser Leistungen aufgrund der Koppelung an Lohn- und Kostensteigerungen. Diese seien natürlich in Ordnung, aber neue Leistungen könne es vorerst nicht geben. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte in Berlin, bereits beschlossene Schritte wie etwa die Kindergrundsicherung seien davon unbenommen
Schulden könnten 2024 weiter sinken
Auslaufende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Energiekrise sorgten allerdings dafür, dass das Minus im Bundeshaushalt diesmal um 45,3 Milliarden Euro kleiner ausfiel als 2022. Rückläufige Transfers des Bundes bei gleichzeitig anhaltenden finanziellen Belastungen zur Versorgung von Schutzsuchenden trugen dazu bei, dass im vergangenen Jahr auch die Länder (6,4 Milliarden Euro) und Gemeinden (12,1 Milliarden Euro) rote Zahlen schrieben. 2022 hatten sie noch Überschüsse erzielt.
Für dieses Jahr rechnen die meisten Experten mit einer weiter sinkenden Neuverschuldung, auch wegen der Sparmaßnahmen des Bundes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Schuldenbremse. Die hohen Preise und Lohnabschlüsse dürften zudem die Steuereinnahmen steigen lassen.
Bremsklötze der deutschen Industrie
Ein weit pessimistischeres Zeugnis gibt es dagegen für die deutsche Wirtschaft: Die kommt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nicht vom Fleck. Zum Jahresende schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,3 Prozent.
Die Industrie, die in Deutschland mit etwa 30 Prozent an der Bruttowertschöpfung ein vergleichsweise hohes Gewicht hat, leidet nicht nur unter gestiegenen Energiepreisen, sondern auch unter schwacher Nachfrage, insbesondere aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr sanken die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe um 5,9 Prozent. Gestiegene Zinsen und Kosten bremsen zudem den Bau aus. "In der Industrie und der Bauwirtschaft sind mittlerweile die dicken Auftragspolster abgeschmolzen, die die Unternehmen noch zu Corona-Zeiten aufgebaut hatten", erläuterte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser jüngst.
"Die Jahre, in denen die deutsche Industrie Job- und Wachstumsmotor für die deutsche Wirtschaft war, sind vorerst vorbei", erwartet Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Vor allem der Energiepreisschock nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit bei den Energiepreisen wirkten fort.
Zudem trifft die Schwäche des Welthandels die exportorientierte deutsche Wirtschaft: Der Wert der Ausfuhren von Waren "Made in Germany" sank im vergangenen Jahr. "Der Gegenwind für die deutsche Wirtschaft kommt neben den hohen Energiekosten vor allem von der schwachen globalen Nachfrage, insbesondere nach hochzyklischen Gütern wie Autos, Werkzeugmaschinen und Chemikalien", analysierten Volkswirte des Kreditversicherers Allianz Trade Deutschland.
Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland gestiegen
Dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt in Europas größter Volkswirtschaft bislang robust, auch wegen des Fachkräftemangels. Nach wie vor suchen viele Unternehmen händeringend Personal. Die Bundesbank sieht derzeit keine Anzeichen, "dass sich die Lage am Arbeitsmarkt durch die schwache Konjunktur spürbar verschlechtern wird".
Die Zahl der erwerbstätigen Menschen erreichte nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr mit 45,9 Millionen den höchsten Jahresschnitt seit der Wiedervereinigung 1990. Neun von zehn der zusätzlichen Jobs entstanden dabei im Dienstleistungsbereich, während es im produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe geringere Zuwächse gab.
Hoffnungsschimmer Privatkonsum
Der robuste Arbeitsmarkt und die tendenziell sinkende Inflation könnten dem Privatkonsum in diesem Jahr als wichtige Konjunkturstütze Deutschland auf die Sprünge helfen. "Positive Nachrichten für die Konjunktur dringen derzeit nur schwer durch, dennoch gibt es sie: Ein solcher Silberstreif ist die absehbare Erholung der privaten Kaufkraft", sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib unlängst. Im vergangenen Jahr hatten viele die Menschen wegen der Inflation beim Konsum gespart.
Ungeachtet zusammengestrichener Konjunkturprognosen, die Deutschland in diesem Jahr als Schlusslicht im Euro-Raum sehen, eilt der Dax von Rekord zu Rekord. Der Leitindex bildet allerdings nur einen Teil der deutschen Wirtschaft ab, die vor allem mittelständisch geprägt ist. Vertreten sind im Dax die 40 größten börsennotierten Konzerne. Es sei nicht das heimische Geschäft, was die Unternehmen an der Börse immer wertvoller mache. Ihre Umsätze und Gewinne erzielten sie zu einem Großteil im Ausland, erläutert Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.
Strukturelle Probleme
Während Länder wie die Niederlande oder Schweden sich nach EU-Prognosen dieses Jahr mit einem ähnlich mageren Wachstum wie Deutschland begnügen müssen, wird etwa Griechenland oder Spanien deutlich mehr zugetraut. Diese Länder profitieren nach Einschätzung von Ökonomen vor allem vom Tourismusboom nach dem Ende der Pandemie.
"Was uns also sonst hilft – ein großer Industriesektor, der profitiert, wenn die Weltwirtschaft boomt und die Energiepreise niedrig sind -, das bereitet uns jetzt Probleme", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest "Tagesschau24". Deutschland habe allerdings auch strukturelle Probleme. "Die Autoindustrie ist in einem Veränderungsprozess. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir laufen auf eine Situation zu mit schrumpfender Erwerbsbevölkerung. Und das macht vielen Investoren Sorgen."
Verlässliche Rahmenbedingungen gefordert
Wirtschaftsverbände kritisieren zudem Überregulierung, marode Infrastruktur, im internationalen Vergleich zu hohe Steuern und politische Unsicherheit angesichts der Auseinandersetzungen der Ampel-Koalition. "Die Unternehmen brauchen dringend verlässliche und bessere Rahmenbedingungen. Das betrifft die Energieversorgung ebenso wie die Fachkräftesicherung und die Infrastruktur", mahnte jüngst DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnte zum Jahreswechsel: "Aus Enttäuschung und vor allem wegen wirtschaftlicher Nachteile am Wirtschaftsstandort Deutschland fallen jetzt immer mehr Investitionsentscheidungen zugunsten des Auslands."
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnte in der "Rheinischen Post" denn auch vor Schwarzmalerei: Das Gerede von Deutschland als "kranker Mann" Europas sei fehl am Platz. "Die unsägliche Schwarzmalerei von manchen Wirtschaftsbossen und Politikern ist die größte einheimische Bremse für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr". Wirtschaft sei zu 80 Prozent Psychologie.
Die große Mehrheit der Deutschen rechnet mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Im ZDF-Politbarometer gaben dies 69 Prozent der Befragten als Erwartung an, wie der Sender am Freitag mitteilte. 28 Prozent rechnen nicht mit einer größeren Veränderung, nur zwei Prozent erwarten eine positive Entwicklung. Die gegenwärtige Wirtschaftslage bezeichnen lediglich zehn Prozent als gut. Das sind so wenige wie seit 14 Jahren nicht mehr. Allerdings beschreiben die meisten Befragten ihre persönliche wirtschaftliche Situation weiterhin als gut. 53 Prozent sagen dies, 36 Prozent halten sie für gemischt und zehn Prozent für schlecht.