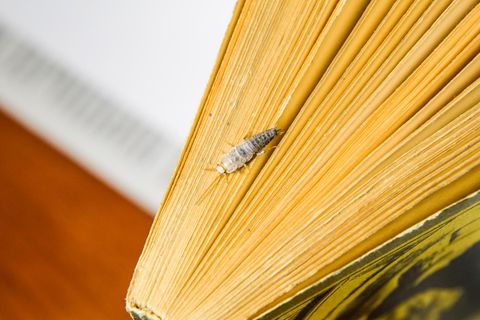1. Gesetzliche Erbfolge
Nur knapp 30 Prozent der Deutschen setzen ein Testament auf. Regiert bei allen anderen Erbfällen das Chaos? Nicht unbedingt. Gibt es weder Testament noch Erbvertrag, regelt der Staat die Verteilung der letzten Habe. Und zwar strikt nach der gesetzlichen Erbfolge. Dazu teilt der Gesetzgeber die Verwandtschaft in verschiedene, abgestufte Ordnungen ein. Erben "erster Ordnung" sind die direkten Nachkommen des Verstorbenen: Seine Kinder - auch uneheliche oder adoptierte - sind die gesetzlichen Erben. Gibt es mehrere Kinder, erben sie zu gleichen Teilen. Ist eines der Kinder bereits verstorben, hat aber eigene Kinder hinterlassen, teilen sich diese an seiner Stelle den Erbanteil. Auch die Enkel gehören also zur ersten Ordnung. Sie gehen jedoch leer aus, wenn die Großeltern sterben und die eigenen Eltern (die Kinder des Verstorbenen) noch leben.
Ist der Tote kinderlos, erbt die "zweite Ordnung". Das sind seine Eltern sowie deren Nachkommen: Geschwister, Neffen und Nichten. Wenn es auch hier niemanden gibt, kommt die "dritte Ordnung" zum Zuge - die Großeltern des Verstorbenen und deren Nachkommen. Generell gilt: Solange ein Verwandter aus der vorrangigen Ordnung noch lebt, gehen die Angehörigen der niedrigeren Ordnungen leer aus. Und wo bleibt der Ehepartner in dem Ordnungsgeflecht? Er hat eine Sonderstellung. Keinesfalls ist er automatisch alleiniger Erbe. Ohne anderslautendes Testament müssen auch Verwandte erster und zweiter Ordnung am Erbe beteiligt werden. Der Anteil des Ehepartners beträgt erbfolgerechtlich zunächst nur ein Viertel des Vermögens. Da Eheleute in der Regel in sogenannter Zugewinngemeinschaft leben, erhält der Partner noch einmal ein weiteres Viertel dazu - als pauschalen Zugewinn dessen, was während der Ehe gemeinschaftlich erarbeitet worden ist. Unterm Strich bekommt der überlebende Ehepartner also die Hälfte des Erbes, die Kinder teilen sich die andere Hälfte.
Auch wenn die Ehe kinderlos ist, fällt dem Partner nicht alles zu. Gibt es noch Erben der zweiten Ordnung wie Eltern oder Geschwister des Toten, erhält der Ehepartner zunächst die Hälfte des Erbes plus ein Viertel als Zugewinnausgleich - zusammen also drei Viertel des Vermögens. Die Erben zweiter Ordnung teilen sich das restliche Viertel. Nur wenn es keine Verwandten erster und zweiter Ordnung gibt, fällt dem Ehepartner alles zu.
Ist die Ehe geschieden, erbt der überlebende Ex-Partner nichts. Das gilt, sobald dem Gericht ein Scheidungsantrag vorliegt. Ausnahme: Hatte der geschiedene Partner Unterhaltsanspruch, müssen die Erben dafür aufkommen - aber nur bis zur Höhe seines Pflichterbteils. Haben Eheleute Gütertrennung vereinbart, erbt der Partner immer gleich viel wie die Kinder. Also bei einem Kind die Hälfte, bei zwei Kindern je ein Drittel. Hat das Paar jedoch mehr Kinder, fällt dem Partner immer ein Viertel des Vermögens zu. Faustregel: Bei Gütertrennung erbt der Ehepartner in der Regel weniger als in der Zugewinngemeinschaft. Im Fall der Gütergemeinschaft gehört jedem der Eheleute die Hälfte des Vermögens - vor und nach dem Tod des Partners. Von der anderen Hälfte bekommt der überlebende Ehegatte ein Viertel, die Kinder teilen sich den Rest. Hat das Paar weder Kinder noch Enkel, fällt dem Partner auch die zweite Hälfte zu.
2. Testament und Erbvertrag
Wer die Regelung seiner Erbangelegenheiten nicht dem Staat überlassen möchte, der sollte ein Testament aufsetzen. Es hat stets Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge. Mit einem Testament kann jeder selbst bestimmen, wer wie viel seines Nachlasses erhält. Zudem lässt sich das Erben an Bedingungen knüpfen. Sinnvoll ist ein Testament vor allem dann, wenn nach dem Tod jemand etwas erhalten soll, der laut gesetzlicher Erbfolgeregelung nichts oder weniger bekommen würde, als man es sich wünscht. So können beispielsweise auch Nichtverwandte berücksichtigt werden. Umgekehrt lassen sich per Testament auch Personen vom Erbe ausschließen - allerdings nicht, wenn ihnen ein Pflichtteil zusteht.
Vor allem Paare, die unverheiratet zusammenleben, sollten rechtzeitig an ein Testament oder einen Erbvertrag denken. Liegt kein "Letzter Wille" vor, erhält ein nichtehelicher Partner laut der gesetzlichen Erbfolge nämlich nichts. Sinnvoll ist ein Testament auch für Eheleute mit Kindern. Beispiel: Ein Ehepaar hat ein Haus gebaut und daneben Geld für die Altersvorsorge gespart. Die Frau hat die Kinder betreut, ihren Beruf aufgegeben. Nun stirbt der Ehemann - ohne Testament. Juristische Folge: Die Mutter muss das Haus verkaufen, damit sie die Kinder auszahlen kann, und mit ihnen auch noch das Ersparte teilen. Verhindern lässt sich dies mit dem sogenannten Berliner Testament. Es setzt Eheleute gegenseitig als Erben ein. Erst nach dem Tod beider Partner geht das Vermögen auf die Kinder über. Das "Berliner" kann man in Eigenregie aufsetzen, nur bei bestimmten Sonderregelungen ist ein Notar notwendig.
Ein Testament kann noch mehr, zum Beispiel etwas "vermachen". Das mag ähnlich klingen wie vererben, ist aber nicht das Gleiche. So kann man dem besten Freund das Gemälde, das ihm sehr gefällt, nicht vererben, sehr wohl aber vermachen. Als "Vermächtnisnehmer" gehört der Freund nicht zur Erbengemeinschaft, die ihm vermachte Sache fällt aus dem Erbvermögen heraus. Wird hingegen einem Mitglied der Gemeinschaft etwas vermacht, zum Beispiel die teure Fotoausrüstung, haben die anderen Erben Anspruch auf Wertausgleich - in bar oder in Form des gleichwertigen Teegeschirrs.
Nicht jeder letzte Wille lässt sich jedoch per Testament regeln. Dann wird ein Erbvertrag nötig. Beispiel: Eine Witwe liegt mit ihrem Sohn im Streit, versteht sich aber mit ihrer Tochter gut. Die Witwe wird zum Pflegefall, und alle drei Parteien schließen einen Erbvertrag: Die Tochter wird Alleinerbin, der Sohn verzichtet auf alles. Im Gegenzug verpflichtet sich die Tochter, die Mutter bis zum Tod zu pflegen und sie nicht ins Heim zu bringen. Jeder Erbvertrag muss von einem Notar aufgesetzt werden. Alle Beteiligten müssen anwesend sein und ihn unterschreiben - eine spätere, einseitige Kündigung ist ausgeschlossen. Und was, wenn etwa Altenheime oder einzelne Pfleger ein "Testament" oder einen "Spendenbeleg" hervorholen, der ihnen ein "Erbe" zuspricht, weil sie den Verstorbenen umsorgt haben? Das "Heimgesetz" untersagt Betreibern von Alten- und Pflegeheimen sowie deren Mitarbeitern, sich über den vereinbarten Betrag für Unterbringung und Pflege hinaus Geld von Bewohnern versprechen oder gewähren zu lassen. Die Zusage einer Spende oder einer Erbschaft ist also rechtlich unwirksam.
3. Enterbung und Pflichtteil
Es kommt in den besten Familien vor: Der Sohn wählt - nach Ansicht der Eltern - den falschen Beruf, die Tochter den falschen Ehemann. Prompt hängt der Haussegen schief, der Streit schaukelt sich hoch, schließlich sind die Verhältnisse zerrüttet. Letzte elterliche Waffe: den Kindern mit Enterbung drohen. Das ist in vielen Staaten möglich, nicht aber in Deutschland. Hier kann der Erblasser seine Angehörigen nicht völlig leer ausgehen lassen. Mindestens ein sogenannter Pflichtteil steht ihnen zu.
Diesen Pflichtteil erhalten aber nur nahe Verwandte: der Ehepartner, die Kinder und die Eltern des Verstorbenen. Auch nichteheliche Kinder sowie deren Mütter oder Väter gehören dazu. Sind die Kinder des Erblassers bereits tot, rücken deren Kinder, also die Enkel des Erblassers, nach. Seine Eltern haben nur dann einen Anspruch, wenn der Erblasser kinderlos ist. Das bedeutet: Ein kinderloser Ehepartner muss das Erbe des toten Partners mit dessen Eltern teilen - es sei denn, das wurde per "Berliner Testament" ausgeschlossen. Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der "Pflichtteilberechtigte" kann vom testamentarischen Erbe nur Bargeld verlangen, jedoch keine Sachwerte wie Familiensilber oder wertvolle Gemälde.
Rechtliche Grenzen
Erbunwürdig?
Was zum Entzug des Pflichterbteils führen kann - und was nicht
Ermordung
(auch der Versuch) sowie die Misshandlung des Erblassers, seines Ehepartners oder seiner Kinder.
Verbrechen gegen den Erblasser
oder dessen Ehepartner wie Urkundenfälschung, Unterschlagung oder Einbruch beim Erblasser, manchmal auch eine schwere Beleidigung. Auch Straftaten gegenüber Dritten wie etwa ein Banküberfall können erbunwürdig machen.
Verletzung der Unterhaltspflicht
gegenüber dem Erblasser. Zahlt etwa der Sohn trotz hohen Einkommens dem bedürftigen Vater keinen Unterhalt, ist er erbunwürdig.
"Ehrloser Lebenswandel"
gegen den Willen des Erblassers: Das ist der häufigste und zugleich umstrittenste Grund für die Entziehung des Pflichtteils. Denn was gegen die "Familienehre" verstößt, unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel. Das Zusammenleben mit einem gleichgeschlechtlichen Partner gehört in der heutigen Zeit nicht dazu, wohl aber die
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Prostitution ist hingegen nicht ehrlos, ebenso wenig Drogenmissbrauch und Alkoholismus, die heute vom Gesetzgeber als Krankheiten aufgefasst werden. Schwierig ist die Lage bei der Zugehörigkeit zu einer Sekte. In dieser Grauzone, für die es keine gesetzliche Regelung gibt, muss ein Richter im Einzelfall entscheiden. Generell gilt: Enterbte müssen ihre Ansprüche in jedem Fall vor Gericht geltend machen.
Nachdem ein Pflichtteilberechtigter vom Erbfall erfahren hat, bleiben ihm drei Jahre Zeit, um seine Ansprüche geltend zu machen - typischerweise via Anwalt. Automatisch wird nichts ausgezahlt. Mehr noch: Der Pflichtteilberechtigte muss seinen Anteil beziffern. Und das kann ein Problem sein. Denn er muss wissen, was zum Nachlass gehört und welchen Wert dieser hat. Dazu kann er von den Erben ein Nachlassverzeichnis verlangen. Darin wird aufgelistet, welche Werte - und welche Schulden - am Todestag vorhanden waren. Ist das Vermögen schwer zu bestimmen, weil beispielsweise ein Betrieb dazugehört, kann der Pflichtteilberechtigte Gutachter schätzen lassen. Die Kosten dafür gehen zulasten des Nachlasses, verringern also den Wert des Pflichtteils. Manche gerissenen Erblasser glauben, durch einen Kniff unliebsame Angehörige doch noch leer ausgehen lassen zu können: Sie verschenken noch zu Lebzeiten Vermögen an beliebte Verwandte oder Freunde. Im Todesfall, so das Kalkül, sei dann eben so gut wie nichts mehr übrig, was zum Vererben und für den leidigen Pflichtteil bleibt.
Diesem Trick hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben: Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren vor dem Tod gemacht wurden, werden zum Nachlass hinzugerechnet: vom Auto über Schmuck und größere Geldbeträge bis hin zu Immobilien. Davon nicht betroffen sind Schenkungen mit Gegenleistung: Wer seinem Nachbarn ein wertvolles Gemälde geschenkt hat, weil der den Garten gepflegt hat, muss nicht befürchten, dass das Bild später zum Erbe gerechnet wird. Schenkungen, die länger als zehn Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. Mit einer Ausnahme: Haben die Eltern ihren Kindern ein Haus geschenkt, das sie selbst bewohnen (juristisch: Nießbrauch), wird das Haus oder die Wohnung beim Pflichtteil immer mit bilanziert. All das ist die aktuelle Rechtslage. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) plant jetzt Änderungen: Schenkungen sollen nur noch zeitlich abgestuft dem Nachlass zugerechnet werden. Konkret: Eine Schenkung im ersten Jahr vor dem Tod würde voll in die Berechnung des Nachlasses einbezogen, zwei Jahre davor jedoch nur noch zu neun Zehnteln - und in jedem weiteren Jahr um je ein Zehntel weniger.
Weiterer Reformvorschlag: Pflegeleistungen sollen künftig Pflichterbteile erhöhen - sofern dies nicht vom Erblasser testamentarisch oder per Erbvertrag geregelt war. Beispiel: Eine kinderlose Witwe wird von ihrer nicht berufstätigen Schwester gepflegt. Die Erblasserin stirbt, ohne ein Testament hinterlassen zu haben. Der Nachlass beträgt 100 000 Euro. Die Pflegeleistung der Schwester ist mit 20 000 Euro zu bewerten. Derzeit würden die Schwester und ein Bruder je die Hälfte erben. Künftig soll der Schwester vom Nachlass der Pflegebetrag von 20 000 Euro gutgeschrieben und der Rest (80 000 Euro) nach der Erbfolgeregel je zur Hälfte verteilt werden. Im Ergebnis bekäme die Schwester also 60 000 statt bisher 50 000 Euro.
4. Steuern sparen und schenken
Nicht nur die Nachkommen interessieren sich für das Erbe. Auch die Behörden sind hinter dem Nachlass her - mit Steuerbescheiden. Allerdings sind die in ihrer heutigen Form vielfach verfassungswidrig. Zu diesem Urteil kam kürzlich das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter monierten, dass die Finanzämter den Wert von vererbtem Vermögen unterschiedlich bewerten. Bislang rechnete der Fiskus Kapitalvermögen wie Bargeld oder Aktien mit dem vollen Wert ab, Immobilien hingegen nicht. Für bebaute Grundstücke gelten die sogenannten Ertragswerte - und die betragen im Durchschnitt nur die Hälfte des Preises, den die Immobilien am Markt erzielen könnten. Noch günstiger kommen die Erben von Betriebsvermögen davon. Ein Unternehmen wird erbschaftssteuerlich oft nur mit einem Bruchteil seines Wertes angesetzt.
Steuern sparen I
Stiften kann jedermann
Man muss nicht die Milliarden eines Bill Gates besitzen, um sich mit der Gründung einer Stiftung selbst ein Denkmal zu setzen. Seit der Vereinfachung im Jahr 2000 boomt in Deutschland das Stiften - und zwar mit wesentlich kleineren Beträgen. Mittlerweile gibt es mehr als 14 000 "Stiftungen bürgerlichen Rechts", die geläufigste Form. Wichtigstes Gründungsmotiv: der Gesellschaft "etwas zurückgeben". Attraktiv ist dies auch für alle, die keine gesetzlichen oder testamentarische Erben haben: Ihr Nachlass fiele sonst an den Staat. Eine Stiftung hält das Vermögen zusammen und verpflichtet es dauerhaft einem vorher festgelegten Zweck. Das kann der Unterhalt des örtlichen Spielplatzes oder die Förderung des Tierschutzvereins sein. Die Stiftung muss von der Aufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes genehmigt werden. Steuerspareffekt: Auf das Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung muss keine Erbschaftssteuer gezahlt werden. Allerdings nicht unbegrenzt. Derzeit können Mäzene bis zu 307000 Euro im Gründungsjahr oder verteilt über die ersten zehn Jahre plus weitere 20450 Euro Zuwendungen pro Jahr steuerlich geltend machen. Bei Ehepaaren gelten die doppelten Beträge. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) will die Summe auf 750000 Euro erhöhen. Der Preis: Das Vermögen gehört der Stiftung, der Stifter hat nichts mehr davon. Stiftungen können ab 50000 Euro gegründet werden. Bei solch kleinen Vermögen empfehlen Experten, sich damit an Gemeinschafts- oder Bürgerstiftungen zu beteiligen. Daneben gibt es Familienstiftungen ohne Gemeinnützigkeit. Erben bekommen nur die Erträge ausgezahlt. Damit kann beispielsweise ein Unternehmer sicherstellen, dass seine Firma nicht zerschlagen wird. Die Familienstiftung unterliegt der sogenannten Erbersatzsteuer, die alle 30 Jahre gezahlt wird. Beratung gibt es unter anderem beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, Telefon 030/ 89 79 47 60 oder im Internet unter www.stiftun gen.org sowie bei Banken und Sparkassen.
Wie ungleich Erben von Bar- und Sachvermögen behandelt werden, zeigt folgendes Beispiel: Ein Vater vererbt seinem Sohn das Geldvermögen und seiner Tochter das Haus, beides ist jeweils 300 000 Euro wert. Das Finanzamt setzt das Barvermögen mit 300 000 Euro an und zieht davon den Freibetrag von 205 000 Euro ab, der Kindern bei einer Erbschaft von ihren Eltern zusteht. Der Sohn muss die verbleibenden 95000 Euro mit seinem Erbschaftssteuersatz von elf Prozent versteuern und zahlt 10450 Euro an den Fiskus. Die Tochter dagegen bezahlt keine Erbschaftssteuer, denn das Finanzamt bilanziert das Haus nur mit seinem Ertragswert von 150 000 Euro (50 Prozent des Marktwertes). Diese Summe liegt unter dem Freibetrag von 205 000 Euro. Die Tochter könnte sogar zusätzlich noch ein Kapitalvermögen von 55000 Euro erben und bliebe steuerfrei. Das Urteil der obersten deutschen Richter zwingt nun die Politik zum Handeln. Experten erwarten, dass manche Immobilienerben bald stärker zur Kasse gebeten werden, vor allem bei größeren Vermögen wie beispielsweise Mietshäusern.
Steuerlich stärker belastet werden könnten auch Erben, die mit dem Immobilienerblasser nicht eng verwandt sind: Ihre vom Fiskus eingeräumten Freibeträge sind gering und die Erbschaftssteuersätze vergleichsweise hoch. Besonders betroffen wären nicht verheiratete Paare, die sich zwar per Testament oder Vertrag erbrechtlich so stellen können wie Eheleute. Erbschaftssteuerlich gelingt das jedoch nicht. Der Staat behandelt nichteheliche Lebenspartner im Erbfall wie Fremde.
Die Folgen sind finanziell gravierend: Partnern ohne Trauschein steht - wie jedem Nicht-Familienmitglied auch - nur ein Freibetrag von 5200 Euro zu. Alles, was darüber hinausgeht, muss versteuert werden. Eheleute dagegen können einen Freibetrag von 307 000 Euro geltend machen. Zudem hat der überlebende Ehepartner einen Versorgungsfreibetrag von 256 000 Euro. Ein unverheirateter Partner hat darauf keinen Anspruch. Und: Nichteheliche Partner gehören zur ungünstigen Erbschaftssteuerklasse III, sie müssen je nach Höhe des Erbes zwischen 17 und 50 Prozent Erbschaftssteuer zahlen. Verheiratete sind in der günstigen Erbschaftssteuerklasse I und zahlen für ihr Erbe oberhalb des Freibetrags nur zwischen 7 und 30 Prozent Steuer. Für den späteren Erbfall bringt der Gang zum Standesamt Paaren also einen erheblichen Steuervorteil. Der klassischen Familie, die ihren Kindern ein Einfamilienhaus hinterlässt, dürfte indes auch das jüngste höchstrichterliche Urteil keine Steuernachteile einbringen. Nach den bisher bekannten Vorstellungen der Bundesregierung soll den Erben eine Immobilie im Wert von bis zu 700 000 Euro auch weiterhin steuerfrei zufallen. Dafür werden allein schon die hohen Freibeträge für Kinder und Ehepartner sorgen, die tendenziell vom Gesetzgeber wohl eher noch angehoben werden. Bei der Mehrzahl der Erbschaften dürfte deshalb selbst nach der neuen Gesetzeslage keine Erbschaftssteuer anfallen.
Steuern sparen II
Schenken noch zu Lebzeiten
Eines vorweg: Verschenken von Vermögen zu Lebzeiten ist nicht ohne Risiko. Kommt es später zu Zwistigkeiten, kann das Geschenk in der Regel nicht zurückgefordert werden. Schenker sollten deshalb ein Rückforderungsrecht vereinbaren. Und: nichts verschenken, was später noch gebraucht wird. Wer dies beherzigt, kann per Schenkung kräftig Steuern sparen. Denn schnell werden die Steuerfreibeträge von Erben überschritten. Zwar hält der Fiskus auch bei einer Schenkung die Hand auf - zu gleichen Sätzen wie bei der Erbschaftssteuer. Doch im Falle einer Schenkung gelten die gesamten Freibeträge jeweils nach Ablauf von zehn Jahren erneut. Beispiel: Der Vater möchte dem Sohn 400000 Euro hinterlassen. Da der Sohn nur einen Freibetrag von 205000 Euro hat, müsste er für 195000 Euro Steuern zahlen. Schenkt aber der Vater zunächst 200000 Euro, fallen keinerlei Steuern an. Verschenkt er nach zehn Jahren nochmals 200000 Euro, ist die gesamte "Erbschaft" steuerfrei. Wichtig: Das Finanzamt muss innerhalb von drei Monaten über den Vermögens-transfer informiert werden. Soll das selbst genutzte Eigenheim an Kinder verschenkt werden, sollten sich Eltern ein sogenanntes Nießbrauchrecht sichern. Dieses ins Grundbuch eingetragene Recht bedeutet, dass die Eltern bis zu ihrem Lebensende in ihrem Haus wohnen können. Geht es um Mietwohnungen, lassen sich durch Nießbrauch weiter die Mieteinnahmen kassieren. Die Beschenkten sind nur auf dem Papier Eigentümer - aber steuerlich fein raus, solange kein Streit um Pflichtteile entsteht. Die Schenkung muss ins Grundbuch eingetragen werden.
Wesentlich ungewisser stellt sich die Auswirkung des Karlsruher Urteils auf die Erben von Betriebsvermögen dar. Bislang sind sie bereits durch besonders hohe Freibeträge und kräftige Bewertungsabschläge privilegiert. Die Große Koalition hat zudem ein Gesetz zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge entworfen - aber noch nicht verabschiedet. Demnach soll der Erbe eines Betriebes von der Steuer befreit werden, sofern er das Unternehmen mindestens zehn Jahre lang weiterführt und die Arbeitsplätze "im Kern" erhalten bleiben. Ob dieses Gesetz aber nach dem Verfassungsgerichtsurteil in seiner bisherigen Form in Kraft treten kann, ist nach Meinung von Fachanwälten fraglich.
Bis Ende 2008 muss der Gesetzgeber die Steuerregeln überarbeiten, so die Vorgabe der Verfassungsrichter. Sollte die Regierung schon in diesem Jahr einen Entwurf vorlegen, könnte ein neues Gesetz bereits für alle Erbfälle ab Januar 2008 gelten. Bis dahin bleibt es bei den alten Regelungen. Wer beabsichtigt, seine Immobilie oder sein Betriebsvermögen den Nachkommen zu vermachen, kann überlegen, ob er dies nicht noch nach dem alten Recht zu den günstigen Bewertungsgrundlagen tut. Solange das alte Recht gilt, rechnet das Finanzamt eine Schenkung mit den derzeit gültigen Freibeträgen und Erbschaftssteuersätzen ab. Sie sind in der Regel genauso hoch wie bei der Erbschaft.
Experten warnen allerdings vor übereilten Schenkungen. Der Steueraspekt sollte keinesfalls der alleinige Grund sein. Denn die Steuern spart nicht der Erblasser, sondern nur der Erbe. In jedem Fall ist es ratsam, sich von Anwälten beraten zu lassen, die sich auf Vermögensnachfolge spezialisiert haben. Den passenden Experten findet man mithilfe der regionalen Anwaltskammern oder auch im Internet, zum Beispiel unter www.anwalt.de oder www. anwalt24.de. Die Erbschaftssteuer kassiert übrigens nicht der Bundesfinanzminister, es kassieren die Bundesländer. 3,8 Milliarden Euro hat sie ihnen im vergangenen Jahr eingebracht. Das ist nicht einmal ein Prozent aller Steuereinnahmen. In punkto Erbschaftssteuer ist Deutschland daher ein extremes Niedrigsteuerland. Bis jetzt jedenfalls.