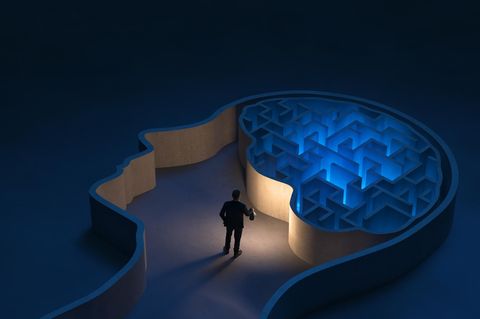Nach dem Corona-Schock war viel vom "neuen Normal" in der Arbeitswelt die Rede. Heute wissen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Das "neue Normal" ist kein fester Zustand, die Arbeitswelt entwickelt sich weiter. In manchen Branchen und Unternehmen haben sich Corona-Entwicklungen wie Home-Office und flexible Arbeitszeiten verstärkt, in anderen wurden sie zurückgeschraubt.
Experten der International Workplace Group (IWG), einem globalen Anbieter von Co-Working-Lösungen, haben sich gemeinsam mit Wissenschaftlern aktuelle Arbeitstrends angesehen und wagen in einem White Paper einen Ausblick auf 2024. Hybrides Arbeiten – heißt es in der Analyse – sei ein weltweiter Megatrend, der sich durch technologische Fortschritte weiter beschleunige.
Aber was bedeutet das für den deutschen Arbeitsmarkt? Wir haben mit Alexander Spermann, Arbeitsmarktforscher und Wirtschaftsprofessor an der Uni Freiburg und der privaten FOM-Hochschule Köln, und Christoph Schneider, IWG-Manager für den deutschen Markt, über die Zukunft des hybriden Arbeitens gesprochen.
Arbeiten wir 2024 mehr oder weniger im Home-Office?
In manchen Unternehmen ist Heimarbeit seit dem ersten Corona-Lockdown der neue Standard. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die zunehmend wieder auf eine verstärkte Präsenz der Mitarbeitenden drängen. In manchen Branchen ist gar eine Art Kulturkampf darum entbrannt, wie viel Home-Office sein soll, kann und darf.
Arbeitsmarktexperte Spermann erwartet dort, wo sich Home-Office etabliert hat, auch 2024 keine Rückkehr zur alten Präsenzkultur. "Die Unternehmen werden auch 2024 auf hybrides Arbeiten setzen", sagt Spermann. "Hybrides Arbeiten zahlt auf die drei D's des deutschen Arbeitsmarktes ein: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie." Bedeutet: Weniger Fahrten ins Büro sparen nicht nur Zeit, sondern auch CO2 und können dank digitaler Arbeitsweisen trotzdem mit hoher Produktivität einhergehen. Zudem seien hybride Arbeitsformen in Zeiten von Fachkräftemangel auch eine Chance, ältere Arbeitnehmer länger im Job zu halten, die gerne noch beruflich aktiv bleiben wollen – ohne jeden Morgen ins Büro fahren zu müssen.
Spermann betont aber auch die Grenzen des Home-Office: "Gerade bei jüngeren Arbeitskräften, die noch relativ neu im Job sind, bringt ausschließliches Arbeiten im Home-Office Produktivitätsnachteile." Sie könnten oft mehr leisten und sich besser entwickeln, wenn sie auch im direkten Kontakt vor Ort arbeiten. Wie das Verhältnis zwischen Präsenz- und Remote-Arbeit am besten ausgestaltet wird, könne nicht nur zwischen verschiedenen Branchen, sondern selbst zwischen verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens stark variieren.
IWG-Experte Christoph Schneider bringt, nicht ganz uneigennützig, eine dritte Alternative zu Zentralbüro und Home-Office ins Spiel. Dezentrale, wohnortnahe Co-Working-Büros, in denen Mitarbeiter zusammenkommen können, ohne ins Headquarter in der City fahren zu müssen. IWG bietet solche Büros in Vorstädten und Wohnvierteln an und will das Angebot in deutschen Städten ausbauen. "Das Büro muss sich an die Lebensrealität der Menschen anpassen", sagt Schneider.
Kommt die Vier-Tage-Woche?
Einen Tag weniger arbeiten, bei vollem Gehalt: Die Vier-Tage-Woche war schon 2023 ein heiß diskutiertes Thema. Befeuert wurde die Diskussion von verheißungsvollen Ergebnissen eines britischen Pilotprojekts, in dem Unternehmen die Vier-Tage-Woche erfolgreich getestet hatten. 2024 starten nun 50 deutsche Arbeitgeber ein solches Experiment. Auch einige Gewerkschaften und Teile der SPD haben bereits ihre Sympathien für die Vier-Tage-Woche erkennen lassen. Bei Tarifkonflikt der Lokführer mit der Bahn geht es maßgeblich um die Arbeitszeit.
Arbeitsmarktexperte Spermann erwartet, dass das Thema Vier-Tage-Woche auch im neuen Jahr wieder aufflammen wird. Schon jetzt beobachtet er einzelne Arbeitgeber, die das Versprechen einer Vier-Tage-Woche als Lockargument im Recruiting einsetzen. Von einer flächendeckenden Umsetzung oder gar einem Recht auf eine Vier-Tage-Woche seien wir allerdings weit entfernt.
Spermann sieht das Thema als Teil einer breiteren Diskussion: "Arbeitgeber, die attraktiv sein wollen, müssen generell flexible Arbeitszeitmodelle anbieten." Manch einer würde vielleicht gerne seine komplette Arbeit an vier Tagen erledigten, um sich einen Tag freizuschaufeln. Andere wünschten sich eher eine Entzerrung der Arbeitszeiten, sodass sie besser mit dem Privatleben oder der Kinderbetreuung korrespondiert.
Wie soll hybrides Arbeiten praktisch funktionieren?
Arbeiten an verschiedenen Orten, arbeiten zu verschiedenen Zeiten: damit das hybride Arbeiten funktioniert und den Unternehmen Vor- statt Nachteile bringt, müssen sie sich gut organisieren. Einige internationale Konzerne haben für diese Aufgabe eine extra Position geschaffen: den Chief Hybrid Officer.
IWG-Experte Schneider erwartet, dass 2024 auch in Deutschland noch mehr Unternehmen einen solchen obersten Manager für die hybride Zusammenarbeit einsetzen. Schließlich berührt das hybride Arbeiten Themen von Immobilienmanagement (wie viele Büros brauchen wir wo?) über Arbeitszeitmodelle bis zu technologischen Fragen (Wie und womit kommunizieren wir?).
Diese Punkte bestimmten letztlich auch maßgeblich die Unternehmenskultur und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Work-Life-Balance, sagt Arbeitsmarktforscher Spermann. Und: "Die Arbeitnehmer haben da höhere Erwartungen als früher."