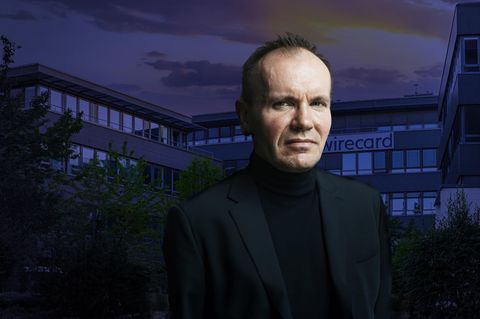Schon früh hat Wirtschaftminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) eine Insolvenz Opels in Betracht gezogen - und dafür heftig Prügel eingesteckt. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier wetterte, man dürfe nicht ständig mit neuen "Schreckgespenstern hantieren". Natürlich steckt hinter der Schelte auch ein wahltaktisches Manöver: Eine Insolvenz setzen hierzulande die meisten Menschen immer noch mit einer Pleite und Massenentlassungen gleich. Selbst Guttenbergs Unionskollege Roland Koch, Ministerpräsident von Hessen, warnte: "Eine Insolvenz ist praktisch eine Liquidation."
Das sehen Experten anders. "Ein Insolvenzverfahren ist nichts Schlimmes. Es ist ein Sanierungsinstrument", sagt Stefan Weniger, Vorstand des Unternehmensberaters CMS AG. In Deutschland hat ein Insolvenzverwalter immer den Auftrag, das Unternehmen nach Möglichkeit zu retten. Das ist in der Vergangenheit in vielen Fällen geglückt. So gelang dem Schreibwarenhersteller Herlitz, der Drogeriekette Ihr Platz, der Filmproduktionsfirma Senator und der Elektrokette Promarkt dank Insolvenz ein Neustart. Oft konnte ein Großteil der Arbeitsplätze erhalten werden.
Auch im Fall Opel könnte eine Insolvenz ein gutes Ende bedeuten, glaubt Unternehmensberater Stefan Weniger. Zwar müsste man den Auto-Hersteller wohl "zurechtstutzen". Aber dafür gebe es ja schon potentielle Investoren, die Sanierungskonzepte für den Patienten entworfen haben. Das ist sonst der Job des Insolvenzverwalters. So gesehen hat die Bundesregierung mit ihrer Investorensuche schon eine Menge Vorarbeit für den Fall einer Insolvenz geleistet.
Was unterscheidet das amerikanische vom deutschen Insolvenzrecht?
Amerikanische Unternehmen müssen sich von Anfang an zwischen zwei Arten der Insolvenz entscheiden. Wenn sie keine Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung haben, beantragen sie das sogenannte Chapter-7-Verfahren. Dann löst man das Pleite-Unternehmen vollständig auf und bezahlt die Gläubiger aus. Die andere Möglichkeit ist das sogenannte Chapter-11-Verfahren, das auch General Motors anstrebt: Bei dieser Variante soll das laufende Geschäft aufrecht erhalten und das Unternehmen gerettet werden. Dafür werden die Forderungen der Gläubiger vorerst gesperrt, damit ein Umbau des Konzerns stattfinden kann. Neue Investoren, die für die Reorganisierung Kredite geben, können bei der Rückzahlung den alten Gläubigern bevorzugt werden. Alte Schulden und ungünstige Tarif- oder Mietverträge können sogar komplett gestrichen werden. Der Besitz des Unternehmens geht meistens in die Hände der Gläubiger über; die Rechte alter Anteilseigner können erlöschen. Die Gläubiger müssen allerdings auf künftigen wirtschaftlichen Erfolg der restrukturierten Firma hoffen, um die Investitionen zurückzubekommen.
Anders als in den USA wird in Deutschland immer ein - unabhängiger - Insolvenzverwalter eingesetzt. Er hat grundsätzlich den Auftrag, das Unternehmen nach Möglichkeit zu retten. Oberstes Prämisse ist zwar, die Forderungen der Gläubiger bestmöglich zu bedienen, aber das funktioniert meistens mit einer Sanierung besser als mit einer kompletten Liquidation des Unternehmens.
Würde Opel nach amerikanischem oder deutschem Recht insolvent gehen?
Grundsätzlich greift bei Opel das deutsche Insolvenzrecht, weil die Adam Opel GmbH eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Deutschland ist. Problematisch ist allerdings, dass Opel seit Jahrzehnten fest zum amerikanischen General-Motors-Verbund gehört und deswegen viele Verknüpfungen bestehen. Beispielsweise muss geregelt werden, ob wertvolle Patente und Lizenzen der Tochter Opel zugeschlagen werden oder bei GM bleiben. Die sind im Falle einer Insolvenz wichtig, weil sich mit ihnen eine attraktivere verkaufsfähige Einheit bilden lassen. So findet sich leichter eine Fremdsanierer. Außerdem gehört GM zu Opels Gläubigern. Der Mutterkonzern muss also dem Sanierungsplan eines deutschen Insolvenzverwalters zustimmen.
Welche Möglichkeiten der Rettung bieten sich bei einer Insolvenz?
Im Regelfall wird in Deutschland zunächst eine vorläufige Insolvenz eingeleitet: Das Vermögen wird gesichert, die Bezahlung der Löhne übernimmt die Bundesagentur für Arbeit. Drei Monate lang hat dann der (vorläufige) Insolvenzverwalter Zeit zu prüfen, wie das Unternehmen möglichst viele Forderungen der Gläubiger bedienen kann.
Wie kann das Unternehmen gerettet werden? Zum einen ist eine Eigensanierung möglich: Der Insolvenzverwalters entwickelt einen Sanierungsplan, dem die Gläubiger zustimmen müssen. Das Unternehmen bleibt im Kern bestehen, die Eigentümer können bleiben. Diese Variante wird allerdings selten gewählt; bei einer Insolvenz haben die Gläubiger gewöhnlich das Vertrauen in das alte Management verloren.
Häufiger wird von der zweiten Möglichkeit Gebrauch gemacht: der Fremdsanierung. Dann wird eine Auffanggesellschaft mit den überlebensfähigen Firmenteilen gebildet, der Insolvenzverwalter kann Verbindlichkeiten und Alt-Verträge, zum Beispiel auch Arbeitsverträge, auflösen. Schließlich sollen die Firmenreste so attraktiv sein, dass ein anderes Unternehmen sie übernimmt.
Nur wenn keine der beiden Optionen - Eigen- oder Fremdsanierung - Aussicht auf Erfolg hat, kommt es zur vollständigen Liquidation des Unternehmens.
Was sind die Vorteile, was die Nachteile einer Insolvenz?
Der Insolvenzverwalter muss nach der Maßgabe handeln, die Forderungen der Gläubiger bestmöglich zu bedienen. Für eklatante Fehlentscheidungen haftet er im Zweifel persönlich. Deswegen wählt er die betriebswirtschaftlich sinnvollste Variante. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Einerseits wird das Unternehmen so umgebaut, dass es beste Chancen auf ein langfristiges Überleben hat. Rücksicht auf politische Befindlichkeiten, zum Beispiel um einen bestimmten Standort besonders zu schonen, wird der Insolvenzverwalter nicht nehmen. Andererseits bedeutet das meistens, dass das Unternehmen stark verkleinert wird. Unattraktive, belastende Firmenteile werden aufgegeben, viele Arbeitsplätze können verloren gehen.
Nachteilig wirkt sich eine Insolvenz auf das Image einer Marke aus: Angestellte, Vertragspartner und Kunden verlieren das Vertrauen in das Unternehmen und seine Produkte. So kann sich die wirtschaftliche Lage kurzfristig noch verschlimmern. Laut Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer waren bei den Insolvenzen von Saab und Chrysler die Verkäufe um 30 bis 40 Prozent eingebrochen.
Für den Staat allerdings - und damit für den Steuerzahler - wäre eine Insolvenz Opels wohl günstiger als das angestrebte Treuhandmodell, das Staatshilfen und -Bürgschaften für den Investor in Milliardenhöhe vorsieht. Interessent Magna plant beispielsweise mit 4,5 Milliarden Euro. Dagegen würde eine Komplettpleite Opels mit Verlust der Arbeitsplätze würde "nur" 1,1 Milliarden Euro kosten. Das habe das Bundeswirtschaftsministerium errechnet, berichtet der "Spiegel".