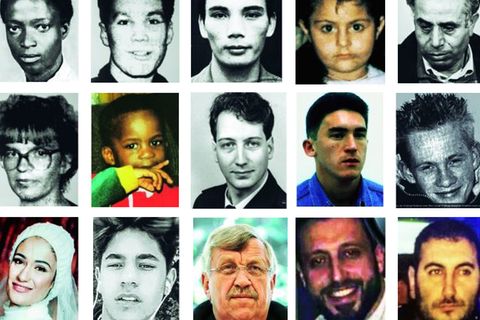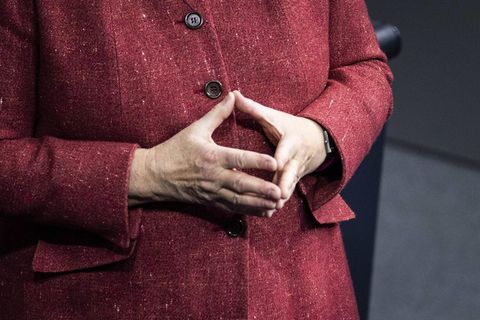Geraten die Olympischen Spiele 2016 für Deutschland etwa zur selbsterfüllenden Prophezeiung? Man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man DOSB-Präsident Alfons Hörmann in diesen Tagen so reden hört. Die deutsche Olympia-Mannschaft ist denkbar schlecht in die Wettkämpfe von Rio gestartet, seit der Wiedervereinigung blieb sie ab Beginn der Spiele nicht mehr so lange medaillenlos. Hörmann befürchtet öffentlich, "dass wir einfach dieses Mal nochmals eindrucksvoll sehen werden, wohin sich der Weltsport entwickelt.“
Er habe bereits vor den Spielen gesagt, dass es schwer werde. Dies habe sich nun bestätigt und Schönrederei helfe da nicht – die DOSB-Athleten seien eben nicht in allen Sportarten konkurrenzfähig: "Wir haben im Weltsport ein Niveau, das wir in zahlreichen Verbänden nicht mehr vollumfänglich mitgehen können."
Deutschland: Interesse am Erfolg, nicht am Sport
Hörmanns Offenheit ehrt ihn, sie ist gerade für einen Sport-Funktionär nicht selbstverständlich. Dem deutschen Sport – oder vielmehr den gesellschaftlichen Strukturen, in denen dieser (nicht) gefördert wird – stellt er damit dennoch ein Armutszeugnis aus. Denn der Trend, der sich in Rio bestätigt, lässt nur einen Schluss zu: Deutschland hat kein gesteigertes Interesse am Sport – sondern höchstens am Erfolg seiner Sportler. Läuft es schlecht, wird gemeckert. Die ersten Unkenrufe werden nach dem aktuellen Fehlstart bereits schon wieder laut.
Das ist die Macht der Gewohnheit, denn in der Vergangenheit wurden die Fans der deutschen Mannschaft zuverlässig verwöhnt: Im ewigen Medaillenspiegel liegt Deutschland mit einem Vorsprung, der auch in den nächsten 100 Jahren nicht einzuholen sein dürfte, auf Rang 3 (allerdings hoffnungslos abgeschlagen hinter Russland auf Platz 2 und den führenden US-Amerikanern). Zumindest aus deutscher Sicht spiegelt dieses Ranking Zustände, die längst der Vergangenheit angehören.
Die aktuelle Situation ist prekär. Mächtiger denn je regiert König Fußball, und danach kommt lange nichts. Selbst Sportarten, die in der Popularitätsskala gar nicht mal so kilometerweit hinter dem Marktführer rangieren, wirken im direkten Vergleich lächerlich klein – das beste Beispiel hierfür war vor wenigen Wochen im Handball zu betrachten: Dem HSV wurde wegen Zahlungsunfähigkeit die Lizenz entzogen, die Bundesliga-Mannschaft musste den Spielbetrieb mitten in der Saison einstellen. Wohlgemerkt handelt es sich beim HSV um den Champions-League-Sieger von 2013 - man stelle sich einen derart rasanten und von der Öffentlichkeit relativ unbeachteten Absturz einmal in einer populäreren Sportart vor. Nur zum Vergleich: 2013 gewann der FC Bayern München die Fußball-Champions-League.
Überhaupt Hamburg: Im vergangenen November sprachen sich die Bürger der Hansestadt gegen die Bewerbung um die Ausrichtung der Sommerspiele 2024 aus. Motiviert durch eine berechtigte Skepsis gegenüber dem IOC und der Sportpolitik im Allgemeinen, wünschte sich die Mehrheit, dass man das Geld doch bitte sinnvoller investieren möge.
Breitensport: Nischendasein statt Massenbewegung
Dass der Zuschlag als Signal eine unbezahlbare Investition in den Breitensport bedeutet hätte, dass er für die Nachwuchsförderung zudem nicht nur finanzielle Vorteile, sondern über Jahre die nicht hoch genug einzuschätzende Zusatzmotivation der Heim-Spiele garantiert hätte, interessierte dabei weniger. So wurde durch den zweiten Anti-Olympia-Volksentscheid nach dem Münchner „Nein“ zu den Winterspielen 2018 eine ohnehin rasante Entwicklung nur verschärft: Der Breitensport wird in Deutschland an den Rand gedrängt – Nischendasein statt Massenbewegung. Das Problem: Ohne Förderung funktioniert es auf Dauer nicht mit dem internationalen Erfolg.
Es stellt sich also die Frage, was Deutschland wirklich will: Konkurrenzfähige Breitensportler und als logische Konsequenz eine erfolgreichere Olympiamannschaft? Oder bloß sportliche Botschafter, für die Dabeisein tatsächlich alles ist – weil sie ohnehin keine Medaillenchancen haben?
Was die letztere Variante angeht, ist man auf einem guten Weg.