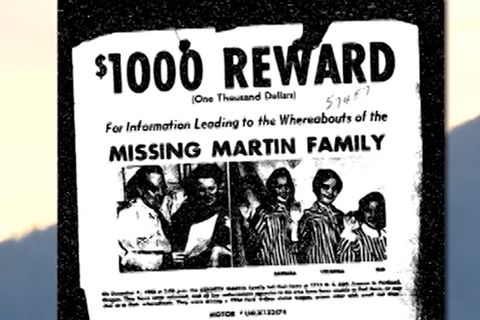Wer ein Videospiel macht, braucht Mut. Zumindest für die großen Spiele, die überraschen und selbst dann noch präsent sind, wenn die Konsole längst ausgeschaltet ist. Mut, neue Ideen zuzulassen. Mut, im Zweifelsfall alles wieder umzuwerfen, was der Entwickler sich bis ins kleinste Detail ausgedacht und akribisch entworfen hat. Selbst wenn es im Kopf noch so schön war, aber im Spiel sperrig wirkt.
Wie zum Beispiel Elizabeth. Die junge Frau ist Hauptfigur im neuen Actionspiel "Bioshock Infinite". Der Spieler soll sie als Söldner Booker DeWitt aus einer rätselhaften, fliegenden Stadt befreien. Und eine Beziehung zu dem unheimlichen Mädchen aufbauen, es beschützen wollen.
Anfangs war sie eine Art Disney-Prinzessin. "Wir haben uns Disney-Filme angesehen und fanden vor allem das Bild der Prinzessin spannend, die aus einem Turm fliehen will", sagt Shawn Robertson vom Spieleentwickler Irrational Games. Wie die naive und zugleich weltkluge Elizabeth, die allein mit einem Haufen Bücher in Gefangenschaft lebt. "Wir haben lange mit solch einer Figur gearbeitet, mussten dann aber nochmal neu anfangen." Jetzt ist sie älter und düsterer als die ehemalige Prinzessin.

Die düstere Disney-Prinzessin
Und noch etwas hat sich geändert: "Die erste Version von ihr war stumm. Wir fanden die Idee brillant, um sie interessanter und hilfsbedürftiger zu machen. Aber das war eine ganz schlechte Idee", sagt Robertson. Für ihn ist die Geschichte um die mysteriöse, fliegende Stadt Columbia schon kompliziert genug. Da braucht der Spieler jemanden, der einem Dinge erklärt und Hinweise gibt, statt stumm durch die Straßen zu laufen. Also auch hier alles neu. An der jungen Begleiterin haben die Entwickler ausgiebig gefeilt.
Sie ist Robertson mit ihrem Verhalten und Charakter so präsent, dass ihr virtueller Geist mit zugegen ist, während er in einem Hochhaus mit Panoramablick auf die Stadt Hamburg von seinem Spiel erzählt. Er weiß genau, was sie machen, wie sie sich bewegen würde, käme sie plötzlich ins Zimmer. Robertson zeigt, an welcher Seite sie vorbei am Tisch und direkt auf das große Fenster zulaufen würde. Sie würde staunend hinaus schauen, die Hände als Sonnenschutz ans Glas über die Augen gelegt. Dann würde Elisabeth aufgeregt etwas kommentieren, was sie draußen sieht.
Vom Meeresboden in schwindelerregende Höhen
Mit dem ausgefeilten Charakter soll Elizabeth vor allem eins: Emotionen beim Spieler wecken. Emotionen? Ein junges Mädchen und eine Stadt in den Wolken? Auch für ein Videospiel nicht gerade alltäglich. Denn "Bioshock Infinite" ist kein Märchenspiel, in dem man herumschlendert und ab und zu ein Rätsel löst. Es ist ein waschechtes Actiongame, ein Shooter. Hier wird gekämpft, geschossen und mit Blitzen geschleudert, bis das Pixelblut strömt. Keine Freigabe für Spieler unter 18 Jahren, meint die USK.
Während die meisten Blockbuster unter den Shootern auf Mehrspielergefechte, lineares Spieldesign in der meist kurzen Kampagne und sich stark ähnelnde Kriegsschauplätze setzen, geht "Bioshock" andere Wege. Mit Erfolg. Die Vorgänger, die in der Unterwasserstadt Rapture spielen, waren Bestseller. Vom Meeresboden in schwindelerregende Höhen, das klingt naheliegend. Meinten die Entwickler auch: "Als jemand aus dem Team die Idee hatte, fanden wir das wirklich zu simpel, ja vorhersehbar. Aber je länger wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr haben wir uns dafür begeistert", so Robertson.
Denn bei Irrational Games wird zuerst der Schauplatz festgelegt. Erst dann kommen Charaktere und die Geschichte. Mysteriös soll er sein und zugleich glaubwürdig wirken. Er soll sich ebenso echt anfühlen wie Elizabeth. Auch beim Vorgänger stand zuerst die Unterwasserstadt Rapture, dann kam der Rest. Zunächst sollte der neue Schauplatz eine dunklere Jugendstil-Variante von Rapture werden, aber das funktionierte nicht richtig. Also hat das Team alles umgeworfen und sich von der Kunststadt White City, dem Ort der Weltausstellung 1893 in Chicago, inspirieren lassen.
Die Stadt als Star
Herausgekommen ist Columbia, die Stadt in den Wolken, die plötzlich verschwindet. Hier muss DeWiit Elizabeth finden. Der schwebende Ort ist der eigentliche Star des Spiels: "Schnell stand fest: Columbia muss ein eigener Charakter sein, nicht einfach nur eine Stadt", sagt Robertson. Hier wirkt auf den ersten Blick alles heiter und verklärt-nostalgisch. Warmes Sonnenlicht scheint auf hübsche Jugendstilhäuser, Parks und Statuen. Farbige Werbeplakate zieren die Fassaden. Willkommen im Jahr 1912. "Das war eine faszinierende Zeit", sagt Robertson. "Mit einer optimistischen Grundstimmung voller Unschuld."
Doch Columbia hat auch eine andere Seite. Eine düstere, groteske mit unheimlichen Wächtern, die dem Spieler auf den Fersen sind. Man meint beim Spielen, die Leichtigkeit der Architektur und der zunächst erscheinende Heile-Welt-Look diene nur als Kontrast, um die Schrecken und Mysterien noch gruseliger und bizarrer wirken zu lassen.
Wichtig war Robertson, dass der Spieler nicht wie bei manch einem Film passiv-skeptisch davor sitzt und das Ganze für unglaubwürdig hält. Er soll in die Szenerie hineingezogen werden. Das funktioniert. Beim Wandern durch die Straßen fühlt der Spieler sich wie ein kleines Kind, das staunend eine neue Welt entdeckt. Wie die gefangen gehaltene Elizabeth. Ständig hat der Spieler den Drang, mehr zu schauen, schnell noch um die nächste Ecke zu sehen und Columbias Geheimnisse zu ergründen. "Wir haben jede Menge recherchiert", sagt Robertson. Über das Design der Zeit, die Politik, all die technischen Veränderungen und die Aufbruchsstimmung im Land.
Zwischen Realismus und Steam-Punk
Als die Epoche fest stand, hat Irrantional Games sich haufenweise Bücher gekauft, im Internet gesurft, alte Fotos angesehen. Und gelesen, gelesen, gelesen. Vor allem "The Devil in the White City" von Erik Larson. Eine Mitarbeiterin vom "Museum Of Fine Arts" in Boston stand ebenfalls Rede und Antwort. Die Architektur sollte ebenso realistisch wirken wie Kleidung, Reklame und Innenausstattung. Auch Straßen und Bürgersteige sollten überzeugen, den Spieler glauben lassen, er sein in einer realen Welt.
Wenn alles vertraut wirkt, ist die Tatsache, dass die Stadt sich über den Wolken befindet, umso phantastischer, überraschender, meint Robertson. Deshalb mischen sich hier auch reale Hintergründe in die fiktive Steam-Punk-Welt, in der die Wunder der Technik auf Nostalgie treffen. So ist hier die Rede vom Boxeraufstand oder der Weltausstellung. Allerdings abgewandelt. Die Ergebnisse all der Stunden Recherche und Ideenfindung haben es dann nicht ins Spiel geschafft. Die Hintergründe über die Spielwelt sind in ein eigenes E-Book ausgelagert.
Ein großes Projekt, an dem rund 200 Leute vier Jahre gearbeitet haben. Recherchiert, designt, vieles umgeworfen und wieder neu kreiert haben. Kunst ist das für Robertson trotzdem nicht. Danach wird er oft gefragt. Es sei einfach der Versuch, den Käufern möglichst viel zu bieten für ihr Geld. Und den Mut zu haben, ständig Dinge zu verbessern und sich neu zu erfinden, wenn es erforderlich ist. Der Aufwand hat sich gelohnt. "Bioshock Infinite" ist nicht nur ein beliebiger Shooter, sondern ein Ausflug in eine völlig andere Welt.