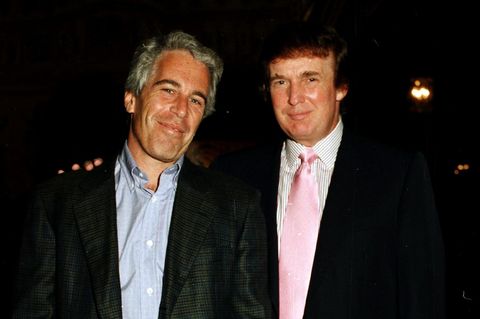Früher, als es noch Dritte-Welt-Läden gab, kauften sich die Mädchen in den Schlabberpullis dort Postkarten und schickten sie an ihre Freundinnen. Auf den Postkarten war eine himmelblau gemalte Weltkugel um die sich wie Girlanden eine Menschenkette schlängelte. Die Menschen waren putzig, bunt, und daneben stand in Schönschrift: "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern." In Frankfurt sind es vor allem junge Männer, die sich mit der Symbolik der Weltkugel schmücken. Die Erde als Puzzelspiel, zu der nur noch ein paar wenige Teile fehlen, das ist das Erkennungszeichen der Online-Enzyklopädie Wikipedia und bei der weltweit ersten Konferenz, der Wikimania, ist diese Weltkugel ein beliebtes Motiv auf weißen T-Shirts.
Unermüdlich, in jedes Mikrofon
Schon der Frankfurter Tagungsort sagt "Graswurzelrevolution": In der Cafeteria des Hauses der Jugend am Frankfurter Mainufer sind die Stühle sonnengelb und blasstürkis, der Kaffee kostet 85 Cent. Hier beraten vier Tage lang Online-Enzyklopädisten aus der ganzen Welt über die Zukunft der Wissensbörse, an der jeder mitschreiben kann. Und die Ideologie, mit ein paar Mausklicks die Welt zu einer besseren zu machen, die ist überall zu spüren. "Unsere Vision ist es, jedem Menschen auf diesem Planeten einen freien Zugang zu einer Enzyklopädie zu ermöglichen." Jimmy Wales, Wikipedia-Gründer und Vorstand der Wikimedia Foundation sagt den Satz unermüdlich in jedes Mikrofon, das ihm in diesen Tagen entgegengehalten wird und wirkt mit seinem stetigen Grinsen und dem gepflegten Vollbart wie ein freundlicher Motivationstrainer. Doch Motivationsübungen, so scheint es zumindest, sind gar nicht mehr nötig. Für die Frankfurter Konferenz haben sich 400 Teilnehmer angemeldet. Weltweit wächst die Zahl der Wikipedia-Fans exponentiell. Schon jetzt umfasst die Wikipedia 2,2 Millionen Artikel, davon rund 260.000 auf Deutsch. Das ist mehr als der Brockhaus und die Encyclopedia Britannica zusammen. Und jeder dieser Artikel wurde von Freiwilligen geschrieben, verbessert, verändert und diskutiert.
Editieren macht süchtig
"Ich habe etwas im Internet gesucht und bin dabei zufällig auf die Wikipedia gestoßen" erinnert sich Gerhard Sattler, und so geht es vielen. "In dem Artikel waren Fehler, die ich korrigiert habe, und schwupps war ich süchtig, habe selbst Artikel geschrieben, andere verändert." Bei der Wikimania trifft der Musiker nun erstmals auf Menschen, die er bisher nur unter ihrem Benutzernamen kannte. Manche, wie der junge Mann, der sich Hochaufeinembaum nennt, mögen ihre wahre Identität allerdings nicht preisgeben. Auch bei einem Projekt wie Wikipedia sind nicht alle Freunde. Bisweilen ist der Umgangston im Netz recht barsch. Von Drohbriefen und Beschimpfungen ist die Rede. Denn nicht alle, die an der Enzyklopädie mitschreiben, haben auch die gleichen Interessen. Auch wenn der neutrale Standpunkt die oberste Maxime im Wikipedia-Universum ist, werden ideologische Konflikte durchaus auch in der Online-Enzyklopädie ausgetragen. "Edit Wars" nennt man im Wikipedia-Jargon die endlosen Kämpfe um die Darstellung. So gibt es zutiefst grundlegende Meinungsverschiedenheiten bei Begriffen wie "Armenien" und "Türkei" aber auch bei eher unverdächtigen wie "Ei" und "Milch". Allgemeines Schmunzeln verursachte kürzlich die Tatsache, dass in der biografischen Notiz über Jürgen Rüttgers im NRW-Wahlkampf der Verweis auf seine Kinder-statt-Inder-Kampagne gelöscht wurde. Die für alle nachvollziehbare IP-Adresse führte direkt in den Bundestag. Altruismus und ein Gefühl der Zugehörigkeit hat der Israeli Tashi Hayat als Motivation der Wikipedianer herausgefunden, ihr Wissen unentgeltlich zu Lexikonartikeln zu verarbeiten. Als jemand dazwischen fragt, ob das denn auch für die Vandalen gelte, lacht der Saal.
"Bin kein Dissident, eher der technische Typ"
Von ganz anderen Problemen berichtet der Chinese Isaac Mao. Die chinesische Regierung hat den Wikipedianern dort im vergangenen Jahr zwei Mal die Seite blockiert, weil sie politische Einflussnahme befürchtete. Mao selbst hat das Blog-Konzept nach China gebracht. Heute schreiben zwei Millionen Chinesen ein Weblog, und die chinesischsprachige Wikipedia umfasst rund 30.000 Artikel. "Ich bin kein Dissident", sagt der 33-Jährige. "Ich bin eher der technische Typ." Und gegen den technischen Fortschritt, glaubt er, kommt nicht einmal die chinesische Regierung an.
Ist der Zugang in den Industriennationen zu Datenbanken und Bibliotheken recht einfach, so zeigt die Wikipedia-Statistik in weiten der Teilen der Erde eine verschwindend geringe Verbreitung. Wo es an Computern fehlt und die Analphabetenzahl hoch ist, kann auch kein Online-Lexikon entstehen. Darum, so der Vorsitzenden der deutschen Wikimedia, Kurt Jansson, wolle man nun verstärkt mit Entwicklungsorganisationen zusammenarbeiten. Für Gründer Wales, der in Frankfurt nur mit dem Spitznamen Jimbo angeredet wird, ist aus dem Freiwilligen-Lexikon längst eine soziale Bewegung geworden, und längst beschränkt sich die Wiki-Community nicht mehr nur auf das Lexikon. In Arbeit sind auch Online-Wörterbücher (Wictionary), Schulbücher (Wikibooks) oder auch allgemein zugängliche Landkarten. Das Ziel des frei zugänglichen Lexikons, so Wales in seinem Eröffnungsvortrag, sei nun zumindest für die großen Sprachen erreicht, nun komme es darauf an, das auf andere Bereiche wie Dateiformate, Produktcodes aber auch die Reproduktion von Kunstwerken und Musikstücken auszuweiten. "Wir wollen so etwas wie das Rote Kreuz für Informationen werden."