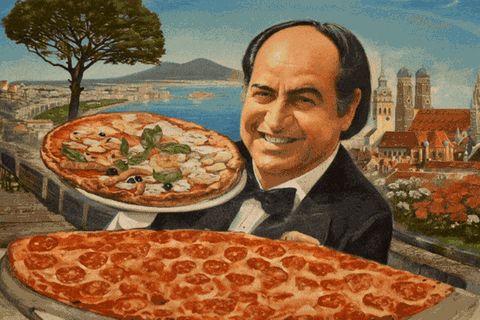Herr El-Mafaalani, wir erleben nun seit Jahren, wie die Rassismusdebatte die deutsche Gesellschaft polarisiert. Nicht nur rechte Parteien sind erstarkt, seit 2015, seit der Fluchtbewegung, haben auch die rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland zugenommen. Dennoch sagen Sie in Ihrem neuen Buch „Wozu Rassismus?“: Wir waren als Gesellschaft in der Rassismusbekämpfung nie weiter als jetzt. Woher nehmen Sie den Optimismus?
Weil die Gesellschaft so offen und liberal ist wie noch nie in der Geschichte Deutschlands. Das führt auch dazu, dass die radikaleren Kräfte als Reaktion immer radikaler werden. Aber das sind Minderheiten, an denen würde ich nicht die Lage im Land messen wollen. Ich schaue eher auf die zwei großen Gruppen: die Leute, die keine Hardcore-Rassisten sind, aber das Thema auch noch nicht wirklich wichtig finden. Und: die von Rassismus Betroffenen. Und auch aus diesen beiden Gruppen würden wohl viele sagen: Es ist alles viel, viel schlimmer geworden. Und daran zeigt sich sehr gut, dass es besser geworden ist. Wenn ganz viele Menschen unzufrieden sind, heißt das in diesem Fall: Wir sind auf dem richtigen Weg.
Das müssen Sie etwas genauer erklären.
Lassen Sie mich das am Beispiel der Polizei machen: Spätestens seit dem Tod von George Floyd lesen wir überall, wie rassistisch die Polizei ist. Wir bekommen also das Gefühl: Hier ist jetzt ein riesiges Problem entstanden. In Wahrheit aber war das Problem ja schon immer da. Der Unterschied ist: Wir reden jetzt darüber, weil Betroffene sich in den vergangenen Jahren eine Öffentlichkeit erkämpft haben. Einerseits heizt das die Debatte an. Andererseits ist das ein klarer Fortschritt. Dadurch, dass über Rassismus bei der Polizei in Nachrichtensendungen und Talkshows gesprochen wird, schrumpft das Problem nämlich bereits. Denn Teile der Polizei beginnen zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen, sich selbst zu hinterfragen. Allein aus Imagegründen. Das hätte es so vor zehn Jahren niemals gegeben.

Dennoch stehen sich auch in dieser Diskussion zwei Lager gegenüber. Die eine Seite sagt: Es gibt strukturellen Rassismus bei der Polizei. Die andere sagt: Es gibt ihn nicht.
Dass es in der Polizei strukturellen oder besser institutionellen Rassismus gibt, halte ich für ziemlich sicher. Wir haben diesen Streit, weil es heute ein Lager gibt, das genau dies thematisiert.
Einen solchen Streit finden wir in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen.
Der Streit ist ein gutes Zeichen. Dass die meisten Menschen das dennoch unangenehm finden, liegt daran, dass wir eine romantische Vorstellung davon hatten, wie eine Gesellschaft auf Veränderung der Machtverhältnisse reagiert. Dass, wenn Migranten, Muslime und Schwarze teilhaben können und das auch tun, es gemütlicher würde.