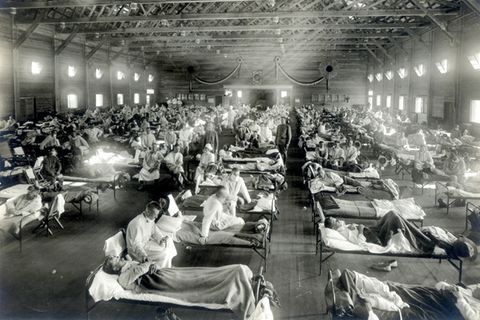Wittower Fähre auf Rügen, dasselbe Bild wie vor zwei Tagen: Dort, wo am Dienstagabend die mit Vogelgrippe infizierten Schwäne gefunden wurden, liegen am Donnerstagmorgen noch mehrere verendete Vögel nahe dem Ufer auf dem Eis. Augenzeugen zufolge sind die Kadaver immer noch frei zugänglich.
Verwunderlich ist das nicht: Zum Einsammeln der toten Vögel stehen ihm nur ein Fahrzeug und vier Mitarbeiter zur Verfügung, sagte der zuständige Amtsleiter Karl-Heinz Walter am Donnerstag. 30 Kilometer lang ist der Amtsbezirk Nordrügen und 20 Kilometer breit, es gibt viele Wasserflächen. Walter schätzt, dass noch mindestens 100 Kadaver zu bergen sind, teilweise liegen sie auf dem brüchigen Eis vor der Küste und können nur schwer geborgen werden.
Informationen über die Vogelgrippe
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat eine Hotline für Bürger eingerichtet, die Fragen zur Vogelgrippe haben. Sie ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr unter den Telefonnummern 01888-529-4601 oder -4602,-4603,- 4604,und -4605 erreichbar.
Weitere Informationen findet man im Internet auf den Seiten des Agrarministeriums, des Friedrich-Loeffler-Instituts und des Robert-Koch-Instituts.
Schutzausrüstungen fehlen
Nach einem strengen Winter werden auf Rügen stets viele tote Vögel gefunden. Normalerweise beunruhigt das niemanden sonderlich - aber normal ist auf der Insel seit Dienstagabend nichts mehr: Jeder tote Vogel gilt als potenzielles Opfer der tödlichen Tierseuche und soll zum Schutze der Allgemeinheit schnellstmöglich geborgen werden. Amtsleiter Walter bittet deshalb um die Hilfe des Kreises, des Landes und des Bundes. Vor allem wünscht er sich einen Hubschrauber, der helfen soll, die toten Tiere aufzuspüren.
Kleinigkeiten verhindern, dass die Arbeiten vor Ort richtig in Gang kommen: Kreis-Ordnungsamtsleiter Günther Schäl sagte am Donnerstag, es gebe freiwillige und über die Arbeitsagentur vermittelte Helfer. Aber für sie seien nicht genügend Schutzausrüstungen vorhanden. Er habe über das Schweriner Innenministerium Ausrüstungen angefordert.
Höhn kritisiert die Rügener Behörden
Wenig Verständnis für die Lage auf Rügen äußerte die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn: In der Bundestagsdebatte über die Vogelgrippe warf sie den regionalen Behörden Versagen vor. "Ein Schnelltest, der vier oder sechs Tage braucht, der ist schief gegangen", rief Höhn dem Schweriner Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zu. Ferner mahnte sie den Einsatz eines mobilen zentralen Einsatzkommandos an. Bereits im ZDF-"Morgenmagazin" hatte Höhn kritisiert, dass am Fundort der infizierten Schwäne weitere tote Tiere erst am Mittwochnachmittag eingesammelt wurden. "Es kann nicht sein, dass möglicherweise infizierte Tiere dort herumliegen über längere Zeit."
Auch FDP-Chef Guido Westerwelle fragte: "Ist es zu verantworten, dass diese Schwäne da rumliegen und sie keiner wegräumt?" Backhaus wies diese Vorhaltungen als "Zumutung" zurück. Die Notfallpläne seien sofort richtig angewendet worden mit Stallpflicht, Sperr- und Beobachtungszonen und Desinfektionen von Ställen und Vorräumen. Viele der verendeten Vögel seien eingefroren gewesen, was das Wegräumen erheblich behindert habe. "Jetzt ist nicht die Zeit für Polemik, sondern zur Information", antwortete er FDP und Grünen.
Keine Überraschungen bot am Donnerstagmittag die Regierungserklärung von Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer (CSU): Er forderte erneut ein "rigoroses und konsequentes" Vorgehen gegen die Vogelgrippe. Eltern sollten ihre Kinder darüber aufklären, dass sie jetzt keine toten Vögel anfassen sollten. Allerdings bestehe kein Grund zur Panik.
40 weitere Schwäne werden untersucht
Auf der Insel Riems werden derweil im Friedrich-Loeffler-Institut 40 tote Schwäne untersucht. Mit Ergebnissen ist noch im Laufe des Tages zu rechnen. Ebenfalls heute wird endgültige Gewissheit darüber erwartet, welchen Vogelgrippe-Erreger die beiden ersten gefunden Schwäne tatsächlich in sich trugen. Das EU-Referenzlabor im englischen Weybridge klärt, ob es sich bei dem bestätigten H5N1-Erreger um das hochpathogene Virus vom Typ Asia handelt. Bisher sind alle bekannten Erkrankungen beim Menschen auf diesen Typ zurückzuführen.
Deutsche Experten hegen aber kaum noch Zweifel daran, dass die Tiere mit H5N1 infiziert waren. Das FLI wies das hoch gefährliche Influenzavirus vom Typ H5N1/Asia eindeutig nach. Eine genetische Analyse der Viren habe eine Verwandtschaft zu H5N1-Viren ergeben, die in der Mongolei und am Qinghai-See in China gefunden wurden, sagte FLI-Sprecherin Elke Reinking.
Die Untersuchungen seien im nationalen Referenzlabor für aviäre Influenza am FLI erfolgt, das seit Mai 2005 zugleich internationales Referenzlabor des Welttierseuchenamtes ist. Eine weitere Bestätigung werde vom EU-Referenzlabor in London erwartet.
Ansteckung bleibt ein Rätsel
Unklar ist weiterhin, wie die Schwäne sich mit dem Virus angesteckt haben. "Die Ursache des nahezu zeitgleichen Auftretens des H5N1-Virus bei Wildvögeln in Italien, Slowenien, Österreich und Deutschland gibt weiter Rätsel auf", sagte der Präsident des FLI, Thomas Mettenleiter. "Die Schwäne könnten aber aus Osteuropa zu uns gezogen sein." Die Schwäne könnten sich bei Wildenten angesteckt haben, die sich wiederum bei Zugvögeln infiziert haben könnten.
Die betroffenen Höckerschwäne seien offensichtlich hochempfänglich für das Virus. Daher könnten sie als geeignete Indikatortiere angesehen werden, die eine Anwesenheit des Virus in der Wildvogelpopulation sichtbar werden lassen. Tote Schwäne würden zudem durch ihre Größe und Färbung schnell in der Umwelt auffallen.