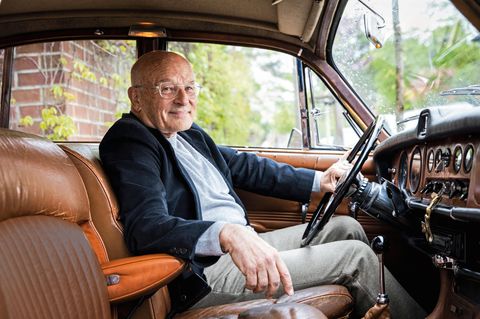Von Sven Michaelsen und Volker Hinz (Fotos)
Herr Kempowski, Ihr Kollege Günter Grass führt mit seiner Novelle über den Untergang des Flüchtlingsschiffes »Wilhelm Gustloff« die Bestsellerlisten an. Muss es Sie nicht rasend machen, dass Grass jetzt den Applaus erntet, der Ihnen zusteht?
Ich gönne ihm diesen Coup von Herzen. Es ist allerdings eine große Unverschämtheit, wenn er über Flucht und Vertreibung nach 1945 schreibt: »Niemals hätte man das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen dürfen.« Was habe ich denn mit den Rechten zu tun? Meine ganze Arbeit zielt darauf ab, unsere Schuld aufzuzeigen. Mich verblüfft auch das kurze Gedächtnis der Journalisten, die behaupten, Grass habe ein Tor aufgestoßen. Mein »Echolot« beschäftigt sich auf 3000 Seiten mit Flucht und Vertreibung. Allein der Abschnitt über die »Wilhelm Gustloff« umfasst mehr als 100 Seiten. Dass sich Grass dennoch als kühner Tabubrecher feiern lässt, finde ich ungehörig.
Halten Sie Grass' Novelle für ein literarisches Glanzstück?
Die paar Ausschnitte, die ich vom »Krebsgang« gelesen habe, finde ich bieder und altmodisch - so, als ob die Zeit an ihm vorübergegangen ist und es Arno Schmidt nie gegeben hätte.
Kennen Sie Grass persönlich?
Kaum. Als ich mal mit seiner Frau redete, sagte er: »Sieh dich vor! Der Kempowski verkauft dir unechten Schmuck.« So was einem ehemaligen Zuchthaushäftling zu sagen ist auch nicht sehr fein.
Sie träumten mal: »Günter Grass ging in unserem Haus von einem Bild zum andern und hat mir gesagt, was ich hängen lassen soll und was abnehmen.«
Guter Traum. Er trifft. Ich habe immer noch den Ranzen auf dem Rücken, wenn ich mit großer Welt zusammentreffe. Ich bedauere, dass es kein Gespräch zwischen uns gibt. Aber was wollen Sie auch mit der Sonne sprechen? Da kann man nur wie ein Hund heulen. Und man heult ja gewöhnlich den Mond an.
Die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« fragte kürzlich: »Wäre es nicht an der Zeit, endlich jene Autoren zu würdigen, die - wie Walter Kempowski - während einer jahrezehntelangen Verdrängung den Mut zur Wahrheit aufbrachten und dafür an den publizistischen Rand gedrängt wurden?« Fühlen Sie sich ausgegrenzt?
Ab und zu lese ich jetzt, ich würde nicht meinem Rang entsprechend gewürdigt werden. Das stimmt wohl. Von vielen werde ich noch immer geradezu boykottiert. Glauben Sie, ich hätte in dreißig Jahren von einem Kultusminister von Niedersachsen auch nur einmal eine Postkarte bekommen?
Dafür haben Sie das Große Bundesverdienstkreuz, einen Bambi und anderthalb Millionen Auflage.
Kein Goethe-Institut lädt mich ein, und die großen Literaturpreise habe ich alle nicht. Da sitzen immer noch die 68er in den Gremien, die nicht verzeihen können, dass ich mich gegen den Sozialismus vergangen habe. Das Schlimmste, was einem Autor passieren kann, ist: Recht zu behalten. Dafür hasst man ihn lebenslänglich. Aber lassen Sie dieses Thema mal. Es beunruhigt mich. Das grenzt bei mir schon an Verfolgungswahn.
Die »New York Times« feiert Ihr »Echolot« als »Sensation«, die »FAZ« als »eine der größten Leistungen der Literatur unseres Jahrhunderts«. Vielleicht bekommen Sie ja doch noch den Büchner-Preis.
Der ist mir inzwischen einigermaßen egal. Die Russen haben mich jetzt ulkigerweise zum Ehrenrittmeister der Don-Kosaken ernannt. Ich habe sogar eine Mütze und eine Peitsche bekommen. Ist das nicht rührend? Dabei kann ich gar nicht reiten.
Jetzt erschien der dritte Teil des »Echolots«, der vom Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion handelt. Warum ist Ihr Buch einem Anatoli Platitsyn gewidmet?
Platitsyn war Oberstleutnant der Roten Armee und Besatzungsoffizier in der DDR. Als er mir schrieb, er sei vom »Echolot« hoch begeistert, forderte ich ihn auf, nach Zeitzeugen des Kriegsanfangs zu suchen. Er hat mir dann Hunderte Interviews geliefert, von Soldaten und Generälen bis zu hungernden Frauen und Kindern im belagerten Leningrad. Mein Bild von den Russen - durch traumatische Erlebnisse verzerrt - wurde zurechtgerückt.
Wann entstand Ihre Idee einer »Mikrogeschichte von unten«?
Im Zuchthaus in Bautzen habe ich jahrelang mit 400 Häftlingen in einem Saal gelebt, ohne Arbeit und meist auch ohne Bücher, von Papier und Bleistift ganz zu schweigen. Was machen Menschen in einer solchen Lage? Sie erzählen von ihrem früheren Leben. Ich hatte den Tick, von Koje zu Koje zu gehen und mir das anzuhören. Als ich einmal abends über den Anstaltshof geführt wurde, fragte ich den Wachtmeister, woher dieses seltsame Gemurmel komme, das in der Luft lag. Er antwortete: »Das sind Ihre 8000 Kameraden. Die erzählen sich was.« Dieser Moment war der Beginn vom »Echolot«.
Warum ließ man Sie in Bautzen nicht arbeiten?
Erst durfte ich als Politischer nicht, dann wollte ich nicht. Ich habe einen 40-köpfigen Kirchenchor geleitet. Dafür sitze ich ja nun nicht, dass ich Akkordarbeit in der Schneiderei mache oder Patronentaschen für die ungarische Armee herstelle!
Warum schreiben Sie in Ihrem Tagebuch: »Vielleicht ist diese Sammelei von Schicksalen mit dem Verwalten eines Zuchthauses zu vergleichen«?
So steht das da? Ich habe seit 1980 in meinem Archiv 6300 unveröffentlichte Tagebücher und 300.000 Privatfotos gesammelt. Für mich ist es von eigenartigem Reiz, mich in die Lebensumstände von Menschen hineinzuversetzen, die meist längst tot sind. Ich habe das Gefühl, ich müsste den Menschen nachträglich Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es ist auch Mitleid. Diese 18-jährigen Abiturienten, die 1939 voller Idealismus in Hitlers Krieg zogen - eine einzige kleine Kugel, und auf einmal ist alles ausgelöscht. Über so etwas komme ich nicht hinweg. Oder wenn ich Fotos sehe, wie gefangene Jüdinnen beim Marschieren die Hände hochheben mussten. Dieses allgemeine Irresein bewegt mich so, dass ich oft nicht schlafen kann. Ich habe ja noch selber Juden mit Stern gesehen, die dann eines Tages verschwunden waren, und keiner fragte: »Wo sind sie?«
Welche mentalen Folgen hat es, sich tagein, tagaus mit Kriegsgräueln und Judenmord zu beschäftigen?
Ich weiß auch nicht, wie ich das seit 20 Jahren durchhalte. Schlaflosigkeit, Überreiztheiten - meine Umgebung kann ein Lied davon singen. Aber man kann sich das nicht aussuchen.
Als Sie einen Schlaganfall hatten, sackten Sie mit den Worten zusammen: »Gott sei Dank, jetzt darf ich aufhören.«
Das war ein seliges Glücksgefühl, das ich Ihnen nicht beschreiben kann.
Ist Ihre Arbeit Sühne?
Ja, denn zum allgemeinen Unrecht, das geschah und täglich noch geschieht, quält mich meine sehr persönliche Schuld, dass ich durch meine Unvorsichtigkeit meine Mutter und meinen Bruder auch ins Zuchthaus gebracht habe. Das kann ich mir nie verzeihen.
Sie wurden wegen »antisowjetischer Spionage« zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt und nach acht Jahren vorzeitig entlassen. Was genau warf man Ihnen vor?
Die Schiffsmaklerei meines Vaters war an der Verschiffung von Demontage-Gütern beteiligt. Als 18-Jähriger machte ich Kopien von Frachtbriefen, die belegten, dass Sachen auch illegal demontiert und nach Russland geschafft wurden. Heute würde das unter Journalismus fallen. Meine Mutter bekam sechs Jahre wegen Mitwisserschaft. Sechs Jahre Zuchthaus, nur weil ich den Mund nicht gehalten habe. Ein einziges Mal ja gesagt statt nein. Einmal! Wie kommt man dazu?
Was brachte Sie dazu, Ihre Mutter zu belasten?
Als ich bei den Verhören durch die Russen keine Mitwisser nennen wollte, musste ich drei Tage lang nackt im kalten Wasser sitzen. Das war natürlich Wasser, wo andere Leute schon reingeschissen hatten, eine so genannte Brühe war das. Es gab weder Rechtsanwalt noch Arzt, und man war immer von fremdsprachigen Menschen umgeben, die einem nie eine Auskunft gaben. Irgendwann war ich dann so weit.
Wie lebten Sie mit Ihrer Schuld?
Als mir in der Einzelhaft klar wurde, was ich meiner Mutter angetan hatte, habe ich natürlich versucht, mich zu beseitigen. Ich band mir ein Taschentuch um den Hals, steckte einen Löffel hinein und drehte es fest. Durch die Strangulation war das Bewusstsein sofort weg. Ich fand mich auf dem Fußboden wieder, zitternd. Es hatte nicht funktioniert. Das war der Tiefpunkt, auf den sich alles bezieht, was ich tue.
Sie haben Ihre Mutter 1956 in Hamburg wiedergesehen. Hasste sie Sie?
Unser Wiedersehen war sehr schön und verlief ganz und gar ohne Vorwürfe. Sie erzählte mir dann auch, dass sie von einem Nachbarn denunziert worden sei! Das war für mich ein Schock, denn mit dem Kerl hatte ich auf einer Zelle gesessen. Wozu die Russen dann überhaupt noch meine Aussage brauchten, ist mir ein Rätsel. Meine Schuld wurde dadurch zu einer metaphysischen Schuld. Mein Gewissen ist dadurch aber nicht entlastet.
Konnten Sie mit Ihrer Mutter über Ihr Schuldgefühl sprechen?
1958 habe ich es einmal versucht, aber sie wollte das gar nicht. So was ist ja auch peinlich. Ich konnte ihr noch nicht mal finanziell helfen, weil ich als Student selbst keinen Pfennig hatte. Für meine Verwandten war ich natürlich der große Verräter, der die arme Gretel ins Unglück gestürzt hat. Zu Recht, nicht?
Hat Ihre Mutter Ihren Ruhm noch erlebt?
Nein. Als sie 1969 im Sterben lag, lag mein erster Roman auf ihrem Nachtschrank. Der Arzt sagte: »Oh, Sie haben einen Sohn, der Schriftsteller ist!« Zu mir meinte sie: »Der soll sich mit meiner Krankheit befassen und nicht mit deinem Buch.« Sie war oft sehr direkt.
Mochten Sie Ihre Mutter?
Hätte sie mir als Kind wenigstens den Gefallen getan, garstig zu sein. Dann könnte ich jetzt das Gefühl haben: Na ja, sie hat ihr Fett weggekriegt, weil sie mir damals das Apfelmus nicht gegeben hat. Aber so war das eben nicht. Sie war liebevoll.
Sie werden von einer »schwer zu ertragenden Unrast« gequält. Woher rührt die?
Ich rase wie angestochen durchs Leben, weil dieses Gefühl immer schlimmer wird, vor Toresschluss noch ein Pensum abarbeiten zu müssen. Nachts sehe ich die Arbeit, die mich bedrängt, und morgens würde ich am liebsten gleichzeitig pinkeln, Zähneputzen und Haare kämmen. Ich bin getrieben von der Vorstellung, ich müsste irgendwas wiedergutmachen. Und da ich es nicht an meiner Mutter gutmachen kann, setze ich mich für ungerecht behandelte Menschen ein. Ich weiß, es klingt großspurig, aber meine Arbeit ist mir aufgetragen. Wenn ich noch drei, vier Jahre habe, kriege ich den letzten »Echolot«-Teil über den Mai 1945 fertig. 12.000 Seiten Rohmanuskript habe ich schon. Das Weitere interessiert mich dann nicht mehr.
Bei unliebsamen Mitmenschen haben Sie schon mal Straffantasien wie: »Kleine Arschtritte, sechs Wochen lang, und dann im Belgischen Kongo aussetzen.« Ihre Familie nennt Sie wegen Ihrer Wutausbrüche »Iwan der Schreckliche«.
Das ist Frotzelei. Ich genieße den Rausch, der mit meinen Kragenplatzereien verbunden ist. Ich weiß, dass ich mir damit schade, aber trotzdem: Der Ärger muss raus. So ein Wutkoller hat den gleichen befreienden Effekt wie eine Ejakulation oder wenn man schön niest.
In Ihrem Tagebuch schreiben Sie: »Je älter man wird, desto fremdartiger kommen einem Frauen vor. Solange man liebt, hat man keine Ahnung von Frauen. (Sonst liebte man wohl auch nicht.)«
Ja? Klingt ganz gut. Aber ohne Frauen ist es eben auch nicht auszuhalten. Solange man Frauen noch liebt, übersieht man ihren Egoismus oder hält ihn für neckisch. Man denkt: Ist doch lustig, dass die sich immer die größere Wurst greifen. Wenn man sich dann der Scheidung nähert, ist das nicht mehr so lustig. Nebenbei gesagt: Meine Frau und ich leben jetzt schon fast fünfzig Jahre zusammen, und es hat nie einen Streit zwischen uns gegeben. Meine Frau ist da allerdings ganz anderer Ansicht.