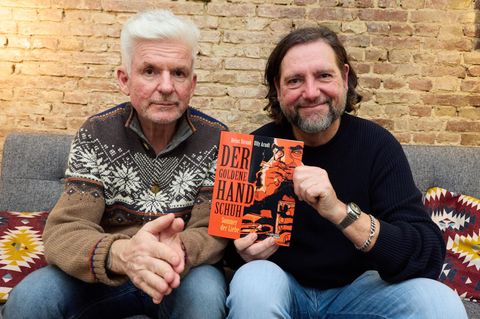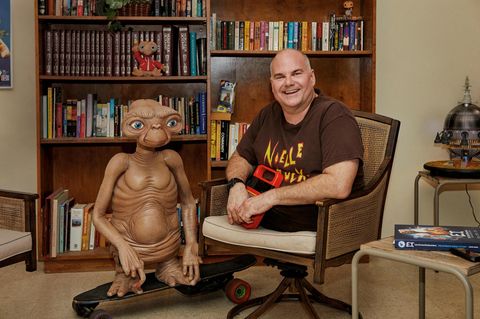Ohne Peter Tamm wäre das "Internationale Maritime Museum" nicht denkbar. Ein Leben lang hat der Marine-Experte gesucht, gehortet, recherchiert und katalogisiert. Nun hat er sich einen Lebenstraum realisiert - mit einem Museum für seine Privatsammlung, die laut Tamm "größte der Welt zur Schiffahrts- und Marinegeschichte".
Peter Tamms Leidenschaft für die Schifffahrt begann bereits im Kindesalter, seine Mutter schenkte ihm im Alter von sechs Jahren 1934 sein erstes Modell, "ein Küstenmotorschiff, Maßstab 1:1250, sehr exakt gebaut, aus dem Kinderparadies Eppendorfer Landstraße", sagt Tamm und erzählt im nächsten Atemzug vom "Wir-Verhältnis" seiner Familie zum Hafen und zur See. Vater und Großvater waren bei der Marine. Und im Krieg.
Zur Person
Peter Tamm, Jg. 1928, war lange Jahre Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre war er ab 1948 als Schiffsredakteur beim "Hamburger Abendblatt" tätig, wurde 1960 Geschäftsführer des "Ullstein Verlages" und zwei Jahre später Verlagsleiter bei "Bild". Von 1968 bis 1991 stand er der Springer-Verlags-Holding vor. Er gehörte zu den engsten Vertrauten des Verlegers Axel Cäsar Springer. Peter Tamm ist heute geschäftsführender Gesellschafter der Koehler/Mittler-Verlagsgruppe und des Schifffahrtsverlags "Hansa". Er ist verheiratet und hat fünf Kinder und acht Enkel.
Marineblau ist Peter Tamms Farbe, die See seine Liebe. Die Karriere im Springer-Verlag stattete Tamm mit dem nötigen Kleingeld aus, seine persönliche Sammlung nach und nach zu einer der umfassensten der ganzen Welt zu machen. Ihre schiere Größe ist ohne Zweifel beeindruckend. Peter Tamm sitzt im Büro des neuen, seines neuen "Internationalen Maritimen Museums". Ein in Ehren ergrauter Mann, der etwas Respektgebietendes an sich hat. Man kann sich vorstellen, dass so jemand gelegentlich auch Angst einflößen kann. Tamm raucht Zigarre, fixiert den Blick des Gegenübers und rattert Zahlen herunter: 27.000 Schiffsmodelle, 50.000 Konstruktionspläne von Schiffen, an die 5.000 Gemälde bedeutender Marinemaler, eine Vielzahl nautischer Geräte, Uniformen, Waffen, Möbelstücke, Porzellan, Silber und Grafiken sowie rund 1,5 Millionen Fotografien enthält seine Sammlung. Plus 47 Originalbriefe des englischen Admirals Horatio Nelson. Und die größte Sammlung von sogenannten Knochenschiffen – das sind von Gefangenen gefertigte Schiffsmodelle aus Tierknochen. Dazu das weltweit einzige Modell von Christoph Kolumbus' "Santa Maria" aus purem Gold.
Aber wichtiger als alle Zahlen ist die Leidenschaft. Tamm erzählt von einer 70-jährigen Sammlerkarriere, spricht über Geschichte, sich ständig wiederholenden Ereignisse, von Naturgewalten, von einem ständigen Kampf. Ohne die Marine, sagt er, wäre "keine Weltgeschichte möglich", und auf jedem Schiff müsse es einen geben, "der das Sagen hat", denn "jede Demokratie braucht einen Führer."
Stimmen zum "Internationalen Maritimen Museum"
"Es ist meine tiefe Überzeugung, dass es zu den Aufgaben jedes mündigen Bürgers gehört, Geschichte zu bewahren, aus der Geschichte zu lernen und sich historische Abläufe zu vergegenwärtigen, um so die Zukunft mit zu gestalten. Meine Absicht ist es, Kunst und Kultur als historisches Gewissen einer Nation zu bewahren und daraus zu lernen, frei von politischen Strömungen und momentanen Anforderungen des Zeitgeistes."
Peter Tamm
"Wir fragen nach wie vor, wo die von uns geforderte historisch ausgewogene und zum Nachdenken anregende Darstellung von Seekriegsrüstung und Seekriegsführung bleibt. Nach dem Lernprozeß, den gerade Deutschland durchgemacht hat, müsste es selbstverständlich sein, dass Krieg und die Welt des Militärs nicht durch distanzlose Präsentation von glänzenden Orden, Uniformen, Marineschinken, der Nachstellung von Seeschlachten und einer spielzeugartigen Anhäufung von Schiffsmodellen vorgeführt werden darf. Wer Krieg thematisiert, darf ihn nicht als ein Sandkastenspiel oder Männerabenteuer präsentieren oder sonst ästhetisch überhöhen, sondern muss ihn in all seiner Schrecklichkeit zeigen."
Friedrich Möwe
"Im Kern, haben wir den Eindruck, geht es dabei um eine Militaria-Sammlung, wobei Herr Tamm die Absicht verfolgt, deutlich zu machen, dass Deutschland eine Großmacht werden sollte oder er deutschen Großmacht-Phantasien nachtrauert."
Lühr Henken vom "Informationskreis Rüstungsgeschäfte"
"Schon der SPD-Senat hat wie blind nach dieser Sammlung gegriffen. Einer Sammlung, die nicht wissenschaftlich ist, sondern eher vom Sammlerfleiß, aber von der Infantilität und dem Autoritarismus des Sammlers zeugt. Das Institut von Peter Tamm hat bislang kein wissenschaftliches Eigengewicht. Er selbst auch nicht. Ein wissenschaftliches Institut zeichnet sich dadurch aus, dass es Fachkonferenzen veranstaltet, Aufsätze veröffentlicht und in die wissenschaftliche Community eingebunden ist. Auch davon kann bei diesem Institut keine Rede sein."
Dr. Klaus Naumann, Historiker im Hamburger Institut für Sozialforschung. Schwerpunkt: Militärgeschichte
"Ob die Sammlung von Herrn Tamm weltweit einzigartig ist, kann niemand außer ihm selbst beantworten. Wer hat die gesamte Sammlung je gesehen? Dass dort alles Wichtige aus 3.000 Jahren Schifffahrtsgeschichte enthalten sei, ist sicher übertrieben. Die Masse ist überwältigend – aber auf Masse kommt es bei einem Museum nicht an! Vielmehr darauf, nach einem bestimmten Konzept eine Auswahl zu treffen und diese so zu präsentieren, dass der unbefangene, unwissende, aber interessierte Besucher nicht "erschlagen" wird, sondern Erkenntnisse über die (deutsche) Marinegeschichte in ihrer Problematik gewinnen kann."
Dr. Dieter Hartwig, Marinehistoriker und Fregattenkapitän a.D.
Es sind Aussagen wie diese, die einen aufhorchen lassen. Sein Museum bezeichnet Tamm als "kleinen Staat" und die Kritik an der Gestaltung der Ausstellungsräume als "echte Hetze". Peter Tamm sieht sein Sammleranliegen verleumdet und nicht verstanden: "Es ist nicht Vielen gegeben, Weitsicht zu haben", sagt er. "Die großen Männer waren immer einsam und allein." Und es klingt so, als spräche er auch über sich selbst.
Peter Tamm ist, um in der Sammlersprache zu bleiben, zweifellos ein Unikat. Eine männliche Erscheinung, hanseatisch freundlich, aber bestimmt im Auftreten. Wenn er über seine Sammelleidenschaft sinniert, kann man seine Begeisterung nachvollziehen. Wenn er über "Führer" oder "Militärgeschichte" spricht, gelingt das nicht mehr.
Die Opfer haben keine Stimme
Handfeste Gründe für dieses Unbehagen liefern die auf zehn "Decks" verteilten Exponate: Die mit Hakenkreuzen bestückten Großadmiralsstäbe Raeders und von Dönitzs - beide immerhin Oberbefehlshaber der NS-Marine - stehen ebenso unkommentiert herum wie die kleinen harmlosen Schiffsmodelle. Dasselbe gilt für das Gemälde von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der im 17. Jahrhundert eine eigene Kriegsflotte aufbaute: Kein Wort darüber, dass er nicht nur an Gold und Elfenbein interessiert war, sondern auch mit Menschenhandel in Westafrika sein Geld verdiente. Oder das Porträt von Kaiser Wilhelm II., der Symbolfigur des deutschen Imperialismus, dessen Devise lautete: "Weltpolitik als Aufgabe, Weltmacht als Ziel, Flotte als Instrument." All das wird nicht historisch eingeordnet - was nicht nur ein ärgerliches Versäumnis, sondern auch einen bedenklichen museumspädagogischen Rückschritt darstellt: Geschichte ist hier nur noch Herrschaftsgeschichte. Die Opfer haben keine Stimme.
Geschichte einer Museumsgründung
Am 12. Februar 2004 wird der Vertrag zum Vorhaben "Errichtung eines internationalen Schiffahrts- und Meeresmuseum Peter Tamm" unterzeichnet. Am 24. Juni desselben Jahres hatte der Senat unter Drucksache 17/3986 der ins Leben gerufenen "Stiftung Peter Tamm sen." insgesamt 30 Millionen Euro für Umbau und Renovierung des Kaispeichers B sowie das Nutzungsrecht für 99 Jahre zugesichert. 2006 wurde ein Freundeskreis für das "Internationale Maritime Museum" gegründet, der sich um Spenden und die Instandhaltung der Sammlung kümmern soll. Der Senat selbst will sich ausdrücklich aus der Ausstellungskonzeption heraushalten. 2006 wird Richtfest gefeiert. Tamms Stiftung erhält weitere 200.000 Euro von der "Deutschen Stiftung Denkmalschutz", die für den Erhalt des Kaispeichers gedacht sind. Trotzdem verzögert sich die geplante Eröffnung nochmals um eineinhalb Jahre. Im Sommer 2008 kann Peter Tamm seine Sammlung schließlich von ihrem Standort an der Elbchausee 277 in die HafenCity überführen.
Kleiner Rundgang
Auf den zehn verschiedenen Decks erwartet den Besucher eine Reise durch die maritimes Geschichte und Weltgeschichte. Beginnend mit der "Entdeckung der Welt: Navigation und Kommunikation" auf Deck 1 über die Entwicklung der Segelschifffahrt, des Schiffbaus und der Arbeit auf dem Schiff, gelangt man zu Deck 5 und 6, wo es um "Krieg und Frieden" und die moderne "Handels- und Passagierschifffahrt"geht. Über Tiefseeforschung und Marinemalerei auf Deck 7 und 8 gelangt man schließlich zur Welt der Schiffsmodelle mit ihren zigtausenden kleinen Exponaten.
Womit wir auch beim Hauptvorwurf an die Ausstellung wären: Sowohl der martialische Charakter, als auch die museale Aufarbeitung der Sammlung seien "kriegsverherrlichend" und "romantisierend", beklagen Kritiker. Viele befürchten, dass Art und Präsentation der Exponate das geplante Museum zur Anlaufstätte für Militaria-Fans und Neonazis machen könnten.
"Koloniale Eroberungen, Sklavenverschiffungen und Verbrechen der deutschen Seestreitkräfte werden verschwiegen und bei allen Exponaten, ob mit Hakenkreuz oder ohne, fehlen Erklärungen und Zusatzinformationen", sagt der unter Pseudonym schreibende Autor Friedrich Möwe. Er ist der vielleicht schärfste Kritiker der Ausstellung. Die von ihm herausgegebene Broschüre "Tamm Tamm. Eine Anregung zur öffentlichen Diskussion" sorgte im Vorfeld der Museumseröffnung für erheblichen Gesprächsstoff.
Die Linken sind schuld
Doch für Peter Tamm sind solche Kritiker nur "Klugscheißer", die ihn und seine Sammlung mit einer "echten Hetze" verfolgen. Dabei sei es die "linke Ecke" gewesen, die maßgeblich an "Kriegen Mitschuld hatte".
Peter Tamm führt den Besucher selbst durch die dunklen Ausstellungsräume. Energisch schreitet er voran, gibt da und dort Anweisungen an Angestellte und dem Reporter die Richtung vor. Zweifelhafte Exponate werden links (bzw. rechts) liegengelassen, lieber möchte er Containerschiffe, Miniaturhafenanlagen und die Tiefseewelt zeigen. Der "Admiral", wie Tamm früher im Verlag genannt wurde, deutet auf ein Modell der Queen Mary. Der Blick des Reporters wandert indes zu einem anderen Schaukasten. "Ist das die Graf Goetzen?" Zum ersten Mal bleibt Tamm kurz stehen, blickt einen prüfend an. Dass dieses Schiff - benannt nach dem ehemaligen Gouverneur der Kolonie Deutsch-Ostafrika, auf dessen Konto mehr als 200.000 tote Sklaven gingen - im Ersten Weltkrieg als Kriegs- und Gefangenschiff diente, steht auf keiner Informationstafel. Wie unschuldig das Modell dagegen im Schaukasten aussieht.
Das Museum öffnet am 26. Juni 2008 um 10 Uhr seine Türen für die Allgemeinheit. Am 28./29. findet auf dem Museumsvorplatz ein Familienfest statt.
Adresse: Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg, Telefon: 040-30092300
Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag: 10-18 Uhr, Donnerstag: 10-20 Uhr, Montag: geschlossen
Eintrittspreise: Erwachsene: 10 Euro, ermäßigt: 7 Euro, Familie: 12/22 Euro.
Mehr Infos unter www.internationales-maritimes-museum.de