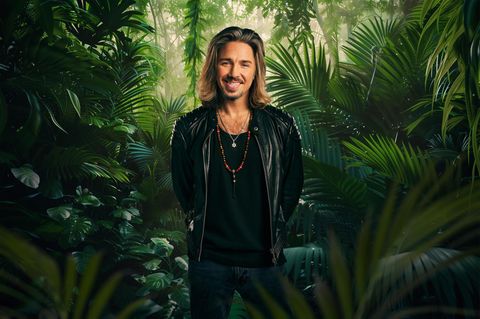Das Portrait über Bibiana Beglau erschien in der stern-Printausgabe Nr. 49 am 27. November 2014.
Maria Furtwängler schaut durch die Panoramafenster des Residenztheaters, Taxis rollen vor, das Münchner Premierenpublikum verstreut sich in die Nacht; sie sagt: "Ich werde einen Fanklub für diese Frau gründen. Von der bin ich so was von begeistert." Die Gepriesene steht ein paar Meter weiter, umringt, belagert: Die Blumen, die Komplimente, alle Blicke gehen an Bibiana Beglau.
Das Haar nass vom Duschen, rot die Rosen in der Hand, strahlt sie eine irritierende Restglut aus. Dieses zweistündige Rappeln und Zappeln bis zum Anschlag, da will der Körper weiter toben und merkt nicht, dass die Lichter aus sind, dass der Jubel verstummt und jetzt mal Ruhe ist. Sie hat sich hineingeschmissen in Martin Kušejs Inszenierung von "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", hat gepoltert und getobt, dass die Scherben flogen und das Bühnenbild knirschte. Ist sie nicht restlos fertig jetzt? "Nee, alles super", krächzt Beglau, die Stimme vom Brüllen noch angerauter als sonst. "Ich könnte glatt weitermachen."
Sechs Theaterstücke hat die 43-Jährige im laufenden Repertoire, alle sehenswert, alle gefeiert. Sie rührt als Mephisto die Hartgesottenen zu Tränen, vergrault in Frank Castorfs Céline-Inszenierung "Reise ans Ende der Nacht" die Empfindsamen, sie ist potthässlich und irre schön, saukomisch oder hochnotpeinlich, und immer geht sie ran an Zuschauer und Werk, ganz nah. Sie ist ihr eigenes Theater.
Manche fürchten ihre sprühende Energie
Im August hat man sie zur Schauspielerin des Jahres 2014 gewählt, das war ein Lohnzettel für längst getane Arbeit. Ihr liebstes Stück zurzeit? "Die sind mir alle auf ihre eigene Art wertvoll", sagt sie. "Auf der Bühne bin ich in eigener Sache unterwegs." Sie ist kurz still, sieht in die Luft, lächelt. "Ich mache halt so meinen Kram." Zum Theater gehöre auch das Scheitern, sagt sie, "und mir ist ein nicht perfekter Theaterabend lieber als ein schöner. Ich bin für die großen Sachen."
Es gibt Regisseure, die fürchten die sprühende Energie der Beglau, ihren Einfluss auf den Gang eines Theaterstücks. "Mit der zu inszenieren, da hätte ich Angst", sagt einer von ihnen und will nicht genannt sein. "Wer weiß, zu was die sich auf der Bühne hinreißen lässt."
"Ist ja krass", sagt sie. "Dass ich so einen Ruf habe." Für Momente sieht sie erschrocken aus, blickt ratlos, aber dann: "Die meisten haben Angst, sich in der Kunst zu verbrauchen. Die einen sind Christoph Kolumbus, die anderen nicht."
Sie sei eigentlich immer freundlich. "Klar, gibt es auch schärfere Töne auf der Bühne, doch das ist auf einer Baustelle, in einem Friseursalon nicht anders." Also hat sie mit den Berserkern des Theaters gearbeitet: mit Christoph Schlingensief, Einar Schleef, Frank Castorf, Dimiter Gotscheff. "Es geht doch darum, sich selber komplett zur Verfügung zu stellen. Das Stück zu benutzen und davon benutzt werden, das ist es."
Im "Tatort" von der Mörderin zur Polizistin
Dass sie auch den Umgang mit der subtilen Komik beherrscht, zeigt sie im "Tatort: Der sanfte Tod". Die Folge wurde im niedersächsischen "Schweinegürtel" eingespielt, und dort bekommt es die erfahrene Kommissarin Lindholm (Furtwängler) mit der Provinzkollegin Bär (Beglau) zu tun. "Wir spielen das ein bisschen wie Pat und Patachon", sagt Beglau, wie das dänische Komikerduo der Stummfilmzeit, "wir haben uns da richtig gefunden." Beruflich war sie schon sieben Mal beim "Tatort" tätig, meist wider Recht und Ordnung, oft als Mörderin. "Man kann sich im ,Tatort' zur Polizistin hochmeucheln", hat sie gelernt – und dass die pure Energie eines Theaterabends im Fernsehen gedrosselt gehört. Das ist dem Medium Fernsehen geschuldet und den zehn Millionen Zuschauern, die ein "Tatort" mit der Furtwängler im Schnitt anzieht.
Wie wird man eine Bibiana Beglau? Man wächst auf in Braunschweig, ist Jahrgang 71 und als Kind schüchtern und still, so gar kein Krawall-Gör. "Ich habe gelesen, gelesen, gelesen. Andere Kinder waren mir suspekt." Die Tochter einer Krankenschwester und eines Bundesgrenzschützers wird in der Waldorfschule sozialisiert, dann von der späten Punkbewegung und deren ästhetischen Ablegern aus der Kategorie Großstadtindianer: "Ich trug lange rote Haare, Skihosen und DDR-Arbeitsschuhe mit Stahlkappe, säurefest." Als Gröl-Punk wurde sie nicht auffällig. "Laut zu sein, habe ich erst am Theater gelernt."
Beglau: "Warum denn den Ball flach halten?"
Welche wundersamen Kräfte im bewegten Körper stecken und was sich aus ihm alles herausholen lässt, das offenbarten ihr die Tanzkünste des Michail Baryschnikow. "Im höchsten aller Sprünge riss der noch ein Bein hoch, es schien, als fliege er. Die ganze Welt denkt, das schafft keiner, aber er zeigt: Es geht!" Mit Anfang 20 besuchte sie ein Konzert der kanadischen Metal- Band "I Mother Earth" und war fasziniert vom Auftritt des Sängers: "Der starrt anderthalb Stunden lang nur auf seine Handfläche und springt auf und ab – dong, dong, dong – wie ein Flummi. Ich habe mich gefragt: Wo kommt diese Energie her?"
Mach mal halblang – bekommt sie selbst diesen Rat von anderen zu hören? "Ja, doch, immer wieder. Aber dann frage ich: Warum denn den Ball flach halten?" Luk Perceval hatte sie 2009 als die 104 Jahre alte Rose Kennedy vier Stunden lang in die Mitte einer Bühne gestellt, aber natürlich bewältigte sie diese Rolle "mit einer gewissen Energie". "Wir versuchen ja ständig, unser Leben auf einer Nulllinie zu halten, was am gesündesten ist. Aber in der Kunst geschieht nichts ohne Amplitude. Da geht's darum, den Moment zu erforschen, wenn der Mensch sich aus sich selbst herauswirft." Puh, hört sich ganz schön anstrengend an, so eine Jobbeschreibung, sie weiß es selbst. Und sagt: "Na ja, ich mache immerzu Rummel. Das muss ich. Sonst werde ich nämlich fürchterlich müde."