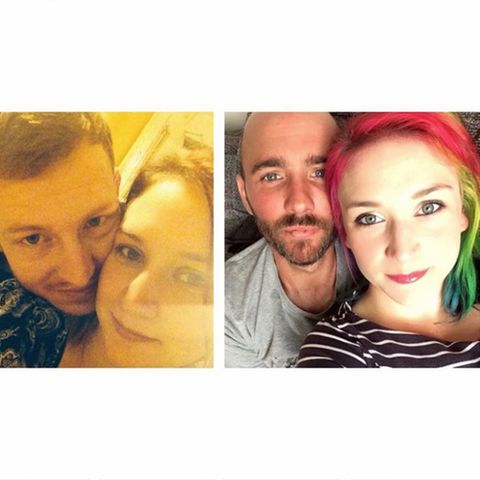Ein Tag im Januar, spät am Abend auf dem Weg nach Hause. Ich genoss den Spaziergang und die Fährfahrt auf die andere Elbseite. Ursprünglich war ich für die Nachtbereitschaft des Kriseninterventionsteams eingeplant, musste diese aber wegen des ungeplanten Frühdienstes am nächsten Tag absagen. Zu Hause angekommen setzte ich mich auf das Sofa. Ich überlegte, ob ich direkt ins Bett gehen oder noch einen Moment wach bleiben sollte. Die Uhr zeigte ein paar Minuten nach neun und ich entschied mich für Letzteres.
Einige Minuten später hörte ich dumpfe, knallende Geräusche aus der Nachbarwohnung. Ich war im ersten Moment nicht beunruhigt, das änderte sich jedoch in Sekundenbruchteilen. Lautes Rufen, anschließendes Klopfen und Klingeln an meiner Tür. Ich öffnete die Tür und sah meine gleichaltrige Nachbarin vor mir stehen, panisch und total aufgelöst: "Mein Freund krampft. Hilf mir!" Das Adrenalin schoß in meinen Kreislauf. Ich lief ihr hinterher, durch das Wohnzimmer zur Küche, und sah ihn auf dem Boden liegen. Leblos mit grauer Gesichtsfarbe. Ich sah einen sterbenden Menschen vor mir.
Trotz des privaten Umfelds und meiner fehlenden, schützenden "Uniform" war mein Kopf auf Rationalität ausgerichtet, glasklar und ruhig, als würde ich dem Schauspiel nur zusehen. Ich sah wie Tina* versuchte mit ihrem Handy den Notruf abzusetzen, gleichzeitig aber nicht wusste, was sie überhaupt tun sollte. "Tina, fang an zu drücken, ich rufe an!"
Die erlösenden Sirenen
Ich wählte die 112, lief gleichzeitig im Treppenhaus zwei Stockwerke höher, um andere Nachbarn dazu zu holen. Am anderen Ende der Leitung meldete ich mich nahezu förmlich, berichtete von der Situation mit Fachbegriffen – ich war zu 100 Prozent in meiner beruflichen Rolle. Jede meiner Handlungen folgte nun einem inneren Leitfaden. Ich lief zurück zu Tina, übernahm die Herzdruckmassage, während ich sie bat die Beatmung zu übernehmen. In meiner Erinnerung brauchte der Rettungsdienst ewig. Ich drückte und drückte. Dann waren die erlösenden Sirenen endlich zu hören. Als die Rettungskräfte in der Wohnung eintrafen, bat ich sofort um eine Ablösung. Inzwischen reanimierte ich seit zehn Minuten.
Schlagartig war der Raum voller Menschen. Eine technische Reanimationshilfe, der LUCAS, wurde auf den Brustkorb von Stefan* geschnallt und in Gang gesetzt. Verpackungen von Spritzen und Flexülen flogen. Das Piepen des Defibrillators. Ich blickte in Richtung des Notarztes, als er den Kopf hob. Unsere Blicke trafen sich, doch er schüttelte nur den Kopf. Wenn ein 27-jähriger Mensch reanimiert wird, ist das Aufhören sehr schwer. Es wird gekämpft, jede Möglichkeit der Behandlung in Betracht gezogen. Er telefonierte mit einem naheliegenden Krankenhaus, gab wenig später das Signal zum Verlegen von Stefan in eben diese Klinik. Er wurde auf eine Trage gepackt, seine Hände an seitlichen Griffen des LUCAS platziert, als würde er sich selbst wiederbeleben. Dieses skurrile Bild werde ich nie vergessen.
Mit der Stille setzen die Emotionen ein
Die Tür fiel ins Schloss, schlagartig war da Stille. Eine Stille, die mein klares Kopfgefühl gegen eine Wand fahren ließ. Nun setzte das emotionale Denken ein. Was war da gerade passiert? Ich fühlte mich völlig schutzlos. Diesmal konnte ich nicht, wie im klinischen Alltag, meine Arbeitskleidung abstreifen und die Tür hinter mir ins Schloss fallen lassen. Ich blieb für einen Moment bei Tina, fragte sie, ob es jemanden gibt, der zu ihr kommen kann, um sie zu unterstützen und ins Krankenhaus zu begleiten. Sie nickte. Ich verabschiedete mich und signalisierte ihr, dass sie sich natürlich jederzeit melden kann.
Mein Bauchgefühl wusste, dass Stefan es nicht schaffen würde. Ein Funke Hoffnung setzte sich dennoch fest, bis zu dem Punkt, an dem man die Endgültigkeit einer Tatsache erfährt und mit den Sinnen erleben muss. Die folgenden Stunden fand ich keinen Schlaf, ich war hellwach. Das Erlebte wirbelte in meinem Kopf umher. Auch im darauf folgendem Frühdienst erlebte ich mich wie ferngesteuert, immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Ich wollte das Erlebte teilen, erzählte es meiner Oberärztin und anderen Kollegen.
Das Gefühl von Schuld im Raum
Als ich nach Hause kam, traf ich wieder auf Tina. Ich nahm sie in den Arm und sie flüsterte, dass er es nicht geschafft hat. Ich warf ihr meine Nummer in den Briefkasten, woraufhin ein paar Tage später ein Brief von ihr folgte. Sie erzählte mir von der Vorgeschichte, dass Stefan im Vorfeld unspezifische Symptome eines Herzinfarktes zeigte, aber eine unglückliche Verkettung dazu führte, dass diese nicht weiter hinterfragt wurden. Hätte man ihn retten können, oder war es einfach seine Zeit zu gehen?
Das schwere Gefühl von Schuld stand massiv im Raum. Fragen, die Angehörige in dem Trauerprozess immer wieder begleiten und die eine Verarbeitung erschweren: Hätte ich mehr tun können? Hätte es eine bestimmte Handlung von mir das Geschehene verhindert? Hätte ich meiner inneren Stimme mehr Gehör verschaffen sollen, aber dafür vielleicht eine Entscheidung meines Angehörigen übergehen müssen?
Fragen, die in der Trauer aufkommen
Auch ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich mehr Präsenz für Tina hätte zeigen sollen? Ob ich hätte da bleiben sollen, um sie ins Herzzentrum zu begleiten, oder zumindest zu warten, bis eine Freundin ihrerseits da ist? Wäre es besser gewesen, nicht einfach mit den Worten "Melde dich wenn du was brauchst!" zu gehen? Denn woher sollte sie wissen, was sie gerade braucht?
"Ich fühle mich schuldig!" Ein Satz, welcher der überwiegenden Zahl aller Hinterbliebenen gemein ist. Zahllose Fragezeichen, ein gedanklicher Kreisverkehr ohne sichtbare Ausfahrten. Besonders schwer zeigt sich das bei plötzlichen Todesfällen und Suiziden. Für die Begleitung ist es essentiell, diese Gefühle wahr und ernst zu nehmen, hinzuhören, was zwischen den Zeilen steht. Im Nachgang hatte ich noch Konversationen mit Tina, in denen deutlich wurde, dass sie ihre Vorwürfe besonders gegen sich selbst richtete. Sie schien zu glauben, in ihrer beruflichen Rolle als Krankenschwester in dieser Situation versagt zu haben. Sie schien sich selbst zu verurteilen und sich nicht verzeihen zu können, so kopflos gewesen zu sein.
Der Kopf versteht, das Herz fühlt jedoch was anderes
Dass es eine völlig physiologische Stressreaktion auf eine lebensbedrohliche Situation ist, versteht der Kopf. Aber das Herz fühlt etwas anderes, und es ist ungemein wichtig, dies ernst zu nehmen, damit Trauer nicht zum Trauma wird. Das Signal zu geben "Ich bin da und höre dir zu, ohne Wertung oder Leugnung deiner Gefühle!" ist essentiell, es hilft. Doch ich habe das Gefühl, dass diese Form der Zuwendung noch in den Kinderschuhen steckt und wir als Gesellschaft es wieder neu lernen müssen, für einander da zu sein.
Trauer, und die damit verbundenen vielfältigen Emotionen, lassen sich nicht ausknipsen. Sie werden sich nicht in Luft auflösen. Mit den Jahren verändern die Gefühle aber ihre Form, werden unscharf und begleiten das weitere Leben wie ein Schatten. Aber mit Hilfe des Austausches und dem Gefühl nicht alleine zu sein, aktivem Zuhören und bewusster Wahrnehmung von außen, ist es möglich sich zurecht zu finden. Nur so ist es möglich, das Schild am Rand des Weges wieder sichtbar werden zu lassen: "Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen."
* Die Namen wurden geändert
Ihr wollt, dass euer Text auch bei NEON.de erscheint? Dann schickt ihn an community@neon.de oder postet ihn direkt in der NEON-Community. Wir freuen uns auf eure Beiträge!