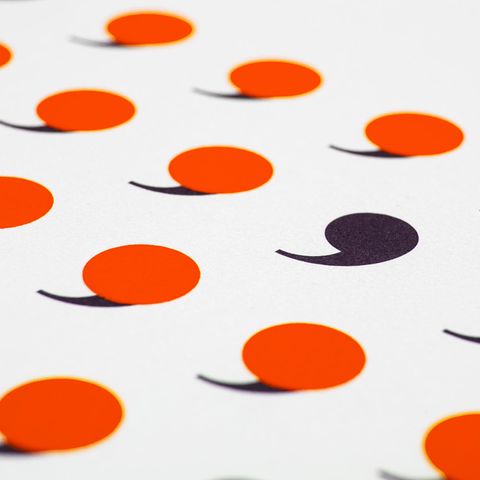Dass der Traumberuf Polizist ausgerechnet an einem Deutschtest scheitern könnte, daran denken wohl die wenigsten, die eine Karriere bei den Ordnungshütern erwägen. Traditionell verbreitet eigentlich eher die Sportprüfung Angst und Schrecken.
Dabei wissen zumindest Krimi-Fans nur zu gut, dass auch Papierkram zum Polizeiberuf gehört. Regelmäßig maulen die fiktiven Kommissare im ARD-"Tatort", wenn sie nach der aufreibenden Verbrecherjagd auch noch ihre Erfolge in einem obligatorischen Bericht aufschreiben müssen.
Seinem Frust Ausdruck verliehen hat jetzt auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung: Jochen Kopelke beklagte darin eine "überdurchschnittliche hohe Durchfallquote" in den Deutschtests für Polizisten. "Nicht sportliche, sondern sprachliche Anforderungen führen am häufigsten zum Scheitern im Auswahlverfahren", sagte der Polizeigewerkschaftler.
Viele junge Leute, die Polizisten werden wollten, schafften die Lückendiktate nicht, beklagte der Gewerkschaftsvertreter. Bei einer solchen Prüfung müssen fehlende Wörter und Satzzeichen ergänzt werden, wie in dem Artikel weiter erklärt wird.
Polizei stellt in jedem Bundesland unterschiedliche Anforderungen an Bewerber
Die Prüfungen für angehende Polizisten sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Hamburg etwa, der Heimat des stern, müssen Interessenten einen mehrstufigen Eignungstest bestehen, wie auf der Karriere-Seite der Hansestadt nachzulesen ist. Dazu gehört demnach ein kognitiver und ein sportlicher Leistungstest sowie eine gesundheitliche Tauglichkeitsüberprüfung.
Im vergangenen Jahr fielen laut Recherchen der "Bild" 65 Prozent der Anwärter in Hamburg durchs Lückendiktat. Daher seien die Diktate dort abgeschafft und durch einen anderen Test ersetzt worden.
Sollte man jetzt generell die Anforderungen für den Polizeidienst senken? GdP-Chef Kopelke sprach sich in dem Interview dagegen aus. "Es gibt einen unverzichtbaren Grundbestand an Fähigkeiten, der nicht zur Disposition stehen darf", führte er aus. Dazu zähle er solide Deutschkenntnisse. Denn Deutsch sei Amtssprache und das zentrale Werkzeug im polizeilichen und verwaltungstechnischen Alltag.
Grund für die schlechten Deutsch-Resultate der Bewerberinnen und Bewerber sind nach Kopelkes Einschätzung Defizite im deutschen Bildungssystem. Auch eine fehlende Sprachförderung in den Elternhäusern spiele eine Rolle. "Viele junge Menschen bringen nicht mehr die sprachlichen Grundlagen mit, die für eine erfolgreiche Polizeiausbildung notwendig sind", beklagte der Polizist.
Quellen: "Bild"-Zeitung, Hansestadt Hamburg