Schreien, Hauen oder plötzlich nur noch bei Mama schlafen: Könnte mal jemand erklären, warum sich Kinder manchmal so verhalten? Unsere Expertin kennt die Gründe. Der stern hat mit der Psychologin und selbst ernannten Kinderdolmetscherin Claudia Schwarzlmüller über elf Situationen gesprochen, die bei Eltern regelmäßig Fragen aufwerfen oder für Verzweiflung sorgen. Das sind ihre Erklärungen.
Das Baby schreit und schreit. Dabei ist es weder hungrig, müde oder krank
Für ein Baby ist Schreien auch eine Bewältigungsstrategie. Häufig versucht es auf diese Weise, Stress abzubauen. Für Eltern kann es hilfreich sein, sich zu überlegen: Was war heute bei uns los? Fällt einem dann auf, dass man ganz schön viele Termine hatte, kann man sich vornehmen, am nächsten Tag weniger zu machen. So kann sich das Baby besser regulieren. Auf keinen Fall sollte man in den ersten Monaten auf die Idee kommen, dass es aus Langeweile schreien könnte und ihm noch mehr Aktivitäten anbieten. Ein Baby ist wahnsinnig schnell überreizt. Man muss sich das so vorstellen: Ständig kommen Hände, Geräusche, grelles Licht, die Lage verändert sich, es muss lernen, seinen Kopf zu halten. All das ist anstrengend. Ein Baby braucht in der ersten Zeit in der Regel nicht mehr Aktivitäten, sondern weniger.

Zur Person
Claudia Schwarzlmüller hat Psychologie mit dem Schwerpunkt Kinder- und Kinderpsychiatrie studiert. Sie arbeitete in der Opferhilfe, in der Kinderpsychiatrie und in verschiedenen Beratungsstellen, bevor sie anfing, Kita-Kinder in Hamburg psychologisch zu begleiten. Außerdem bietet sie Fortbildungen für Erzieher und Therapeuten an und ist Autorin des Buches "Die Kinderdolmetscherin – was dein Kind fühlt, denkt und wie du damit umgehst". Schwarzlmüller lebt in Hamburg und hat zwei erwachsene Söhne.
Der Anderthalbjährige matscht in seinem Essen herum und kippt ständig seinen Becher aus
Kinder in diesem Alter sind perfekte Wissenschaftler. Sie möchten lernen, die Welt zu verstehen. Deshalb experimentiert ein anderthalbjähriges Kind mit allem, was ihm in die Finger kommt. Beim Essen möchte es zuerst die Konsistenz begreifen – erst dann landet etwas in seinem Mund. Wir würden ja auch niemals etwas probieren, das wir nicht einmal anfassen mögen. Und was den Trinkbecher angeht: Es dauert bis zum Vorschulalter, bis man verstanden hat, wie Wasser sich verhält. Das lernt das Kind durch viel Herumprobieren.
Der Zweijährige möchte unbedingt mit dem pinken Löffel essen. Ist der aber gerade in der Spülmaschine, fängt er an zu schreien
Bei Kindern ist es so: Wenn es eine Regel oder einen Ablauf gerade verstanden hat, dann soll alles bitte auch so bleiben. Hat sich das Kind zum Beispiel gemerkt: Ich esse morgens mit dem pinken Löffel, dann reagiert es verzweifelt, wenn diese Regel plötzlich geändert wird. Es hatte doch gerade begriffen, wie es läuft! Auch beim Spielen oder Vorlesen lieben Kinder Wiederholung und Routine. Sie finden es toll, wenn alles immer nach genau dem gleichen Muster abläuft.
Das Kind dreht durch, wenn das Brot falsch geschnitten ist
Es gibt da ein großes Missverständnis zwischen Eltern und Kindern: Im Gegensatz zu seinen Eltern interessiert sich ein Kind hauptsächlich für den Prozess, nicht für das Ergebnis. Es geht ihm also häufig gar nicht um Dinge wie ein perfekt geschnittenes Brot, sondern darum, dass man ihm den Prozess weggenommen hat: Es wollte sich sein Brot selber machen! Lässt man sein Kind so viel wie möglich selbst erledigen – und hält das dadurch entstandene Chaos aus –, merkt man schnell, dass das Kind viel zufriedener ist. Es möchte kein passiver Empfänger von Dienstleistungen sein, sondern ein aktives Mitglied der Familie.

Der Zweijährige kneift und beißt andere Kinder
Es ist superschwer, Sozialverhalten zu lernen, dafür brauchen Kinder Jahre. Sie müssen zuerst einige Dinge lernen: zu beobachten, Gesichtsausdrücke zu lesen und soziale Situationen zu verstehen. Der nächste schwierige Schritt ist dann: Wie reagiere ich darauf? Viele Kinder wissen noch nicht, wie sie sich selbst so regulieren können, dass andere Lust haben, mit ihnen zu interagieren. Und darum beißen, hauen oder kneifen sie. Wenn ihnen zusätzlich noch die Sprache fehlt, ist es besonders schwierig. Eltern sollten wissen: Mit Reden erreicht man in so einer Situation wenig, es geht um die richtige Haltung. Klar, liebevoll – aber bestimmt. Mit einem langen Satz wie "Du, mein Schatz, das finde ich aber nicht so schön, dass du jetzt haust, das macht man nicht", kann ein Kind nichts anfangen. Ein "Nein" oder "Stopp" ist da wirkungsvoller. Man setzt eine klare Grenze, nimmt es aus der Situation heraus oder stellt sich dazwischen. Das Kind muss lernen: Das geht so nicht. Wiederholung ist dabei sehr wichtig.
Die Dreijährige ist sprachlich sehr weit. Aber seit sie einen kleinen Bruder hat, brabbelt sie wieder in Babysprache
Das Schöne bei Kindern ist, dass sie ihre eigenen Wege finden, um auf Veränderungen zu reagieren. Wenn sie etwas Schwieriges erleben, gehen sie häufig ein paar Entwicklungsschritte zurück. Hat ein Kind ein neues Geschwisterkind bekommen, verändert sich die gesamte Familienkonstellation. So kann es passieren, dass es die Lösung findet: Dann werde ich jetzt einfach auch selbst wieder klein. Außerdem sieht es vielleicht, dass das neue Geschwisterchen von allen bestaunt wird – da ist es doch eine gute Methode, selbst auch klein und niedlich zu werden, oder? Nicht selten wollen die etwas größeren Geschwisterkinder dann plötzlich auch wieder aus der Babyflasche trinken. Aber keine Angst: So etwas ist nur von kurzer Dauer. Danach will es ganz von alleine wieder groß sein.
Zu Hause plappert die Vierjährige wie ein Wasserfall, in der Kita sagt sie kaum einen Ton
Ganz viele Kinder wollen einfach erstmal beobachten, was um sie herum so los ist. Das ist so, als ob man auf eine Party geht, auf der man nicht alle Leute kennt und einordnen kann. Sehr wenige von uns würden da reinkommen und sagen: "Hey! Wie gut, dass ich endlich da bin." Meistens versucht man erstmal, die Situation einzuschätzen. Kinder machen das genauso. Und manche nehmen sich dafür eben mehr Zeit. Der Satz "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht" gilt ganz besonders für Kinder. Vielleicht braucht das Kind gerade diese Phase, in der es einfach nur schaut, lernt und wieder schaut. Wenn das Kind nach den ersten Wochen noch immer nicht spricht, kann man gemeinsam mit den Erzieherinnen oder Erziehern versuchen herauszufinden, ob noch etwas anderes dahinter steckt.
Die Fünfjährige kommt jede Nacht ins Elternschlafzimmer
Das Thema "Schlafen" ist ein riesengroßes. Es ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, wie selbstständig Kinder da schon sein sollen. In der westlichen Kultur erwartet man, dass das Kind am besten schon mit einigen Monaten alleine durchschlafen kann. Bei einigen Naturvölkern geht man davon aus, dass ein Kind erst mit etwa sechs Jahren so weit ist. Auch danach kann es immer wieder Situationen geben, in denen das Kind Angst hat oder am Tag etwas erlebt, das stärker verarbeitet werden muss – und doch wieder zu seinen Eltern kommt oder nach ihnen ruft. So ein Verhalten ist ganz normal. Spätestens wenn das Kind ein Teenager ist, wird sich dieses Thema komplett erledigt haben.
Die Sechsjährige steht während des Essens auf und rennt durch die Wohnung
In diesem Alter haben Kinder häufig einen sehr hohen Bewegungsdrang. Eltern sollten sich den Alltag einmal genau anschauen und überlegen, wie häufig ihr Kind sitzen soll. Ob beim Frühstück, im Morgenkreis in der Kita oder – falls es schon zur Schule geht – im Klassenzimmer und bei den Hausaufgaben: Es gibt unendlich viele Situationen, in denen wir von einem Kind erwarten, dass es sitzt. Wenn es für eine Familie trotzdem wichtig ist, dass das Kind am Tisch bleibt, dann sollten die Eltern dafür sorgen, dass es sich davor oder danach als Gegengewicht viel bewegen kann. Oder aber man versucht, eine Regelung zu finden, mit der alle gut klarkommen, etwa, dass die Kinder zwar irgendwann aufstehen dürfen, aber klar ist: Gegessen wird am Tisch. Beim Essen hat jede Familie ihre eigenen Regeln, es gibt da kein Richtig und kein Falsch.
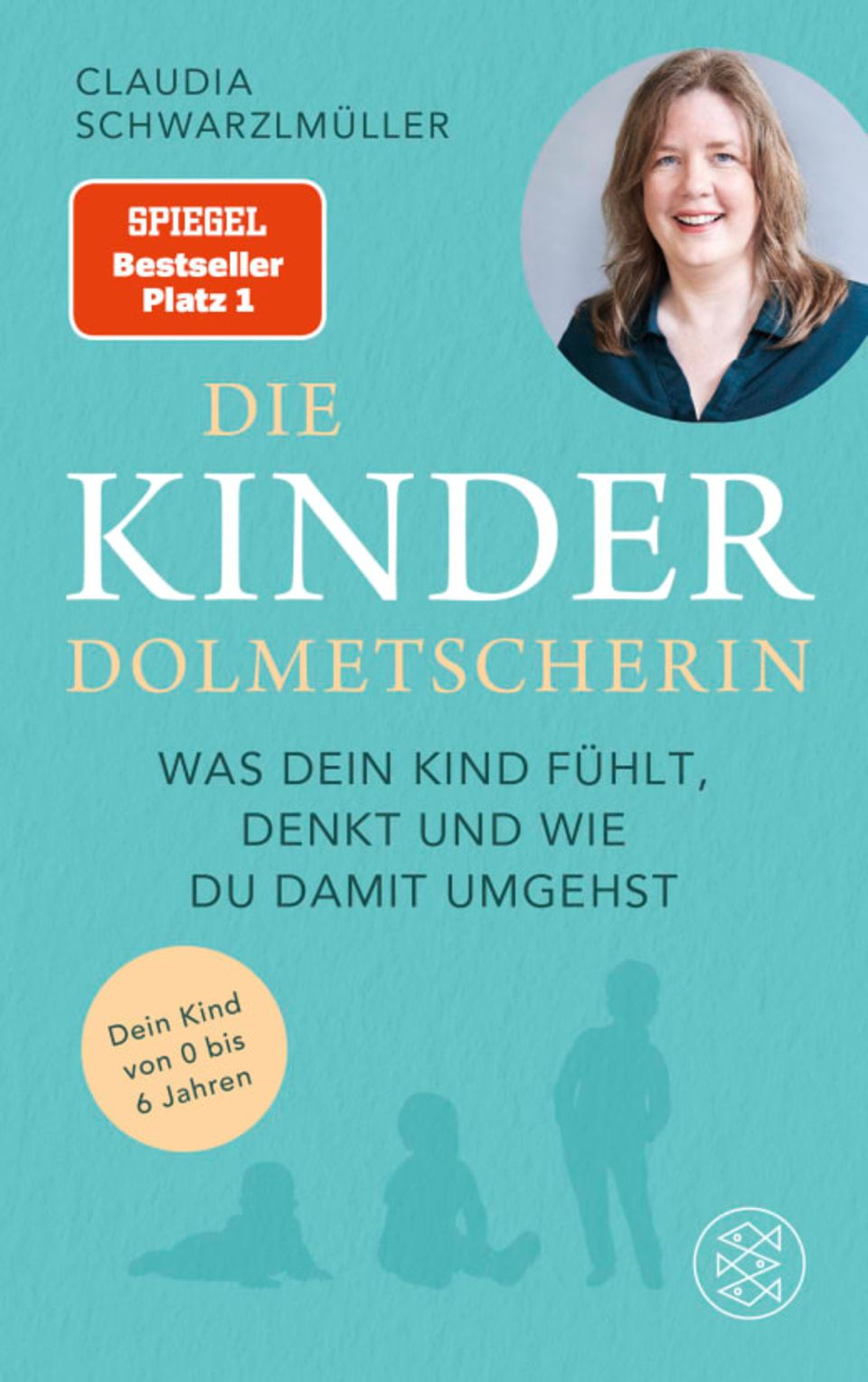
Vom Turnen, zur Verabredung, zum Einkaufen – ein solches Programm ist mit dem Siebenjährigen undenkbar. Wenn der Tag zu voll ist, brüllt er
Jeder Mensch ist anders. Einige Kinder finden Abwechslung ganz toll, anderen fällt es schwer, sich auf neue Situationen einzustellen. Das kommt sehr auf die jeweilige Persönlichkeit an. Für manche Kinder sind vor allem die Übergänge von einer Sache zur nächsten schwierig. Sie müssen sich ja immer komplett neu auf eine Situation einstellen. Was uns dabei häufig nicht klar ist: Als Erwachsener gucke ich auf das große Ganze, für ein Kind ist die Welt eine Ansammlung von vielen kleinen Details. Es sieht die Unebenheiten der Fliesen und hört Dinge, die wir selber gar nicht wahrnehmen, etwa ein Flugzeug, das in der Ferne vorbeifliegt. Da kann es schnell passieren, dass ihm alles zu viel wird. Vielleicht gibt es dann etwas, das dem Kind Sicherheit gibt, eine klare Tagesstruktur zum Beispiel.
Der Achtjährige benutzt ständig Schimpfwörter und wird schnell aggressiv
Schimpfwörter lernen Kinder häufig von anderen Kindern. Und sie merken schnell, dass sie eine starke Wirkung haben: Die Erwachsenen regen sich wahnsinnig auf, wenn diese Wörter fallen. Es gibt viele Situationen, in denen Kinder sich nicht gerade mächtig fühlen – diese Wörter aber verschaffen ihnen diesen Effekt. Als Eltern sollte man da nicht so sehr drauf anspringen. Ich weiß, das ist schwer. Jede und jeder hat seine persönlichen Vorstellungen und wird von einigen Wörtern getriggert. Trotzdem ist es toll, wenn man ruhig bleibt und nur etwas sagt wie: "Achso, ja, das Wort finde ich nicht so toll" und es danach ignoriert.
Was die Aggressionen angeht, würde ich den Achtjährigen direkt fragen, was los ist. Im Alter von etwa sieben Jahren fangen Kinder an, logisches Denken zu entwickeln. Die Frage nach dem "Warum" können sie dann häufig schon gut beantworten. Also nicht einfach nur sagen: "Hauen ist blöd, lass das mal", sondern nachfragen. Es hilft, sich selbst klarzumachen, dass Hauen und Schubsen in diesem Alter Symptome sind. Und es unser Job als Eltern ist, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt.








