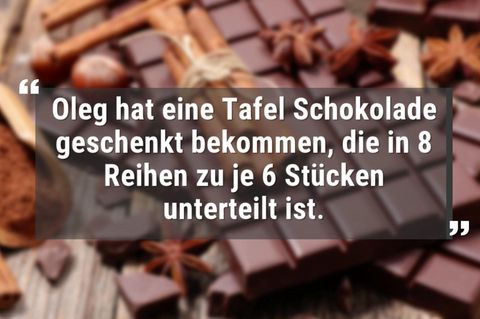Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, ins Bett kuscheln - und dann ran an die Matheaufgaben! Klingt skurril? Mitnichten, finden Forscher aus den USA. Sie raten Eltern, statt zur Guten-Nacht-Geschichte mal zum Zahlenrätsel zu greifen. Die Gruppe um Talia Berkowitz von der Universität von Chicago zeigte in einer Studie, dass das gemeinsame, spielerische Lösen von mathematischen Problemen die Kinder auch im Matheunterricht nach vorne bringt.
Das klingt erstmal banal, doch während das Vorlesen für viele Familien zum normalen Tagesablauf dazugehört, sind Zahlen, Formen und Rechnen kaum Thema. Dabei gäbe es Möglichkeiten genug: "Wenn jetzt jeder ein Stück Kuchen nimmt, wie viele sind denn dann noch da?“, “Oma wird heute 73. Wie viele Jahre ist sie älter als ich? Und als du?“. Die Beispiele zeigen: Kleine Rechenaufgaben lassen sich ganz leicht in den Alltag einbinden. Doch vielen Eltern fällt das offenbar schwer. Mag es noch relativ leicht sein vorzulesen, auch wenn man selber keine Leseratte ist, fehlt es beim Thema Rechnen häufig an Kreativität oder passenden Materialien. Manche Erwachsene haben auch geradezu Angst vor Mathe. Sie sind vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit verunsichert und meiden das Thema, wo sie nur können. Diese Abneigung kann auch auf die Kinder übertragen werden und diese verunsichern.
Die Lösung für solche Familien liefern die Forscher gleich mit: Eine App, deren Nutzung Anlass gibt, sich mit dem Kind auch mal über Zahlen zu unterhalten - und zwar ganz entspannt.
Schon einmal die Woche knobeln hilft
Um den Einfluss von regelmäßigen, kleinen Matheaufgaben auf die Leistungen der Kinder zu testen, arbeitete Berkowitz mit 587 Erstklässlern und ihren Familien. Diese bekamen einen Tablet-Computer und wurden in eine Lese- und eine Rechengruppe aufgeteilt. Die Lesegruppe war angehalten eine Vorlese-App zu nutzten, die neben kleinen Geschichten auch passende Aufgaben zu Textverständnis und Vokabular anbot. Die Rechengruppe hatten ebenfalls eine App zur Verfügung, mit der sie mathematische Textaufgaben und Spielereien lösen konnten. Den Familien wurde empfohlen, sich vier Mal die Woche mit der App zu beschäftigen, zum Beispiel vor dem Schlafengehen.
Am Anfang des Schuljahres gab es noch keinen Unterschied zwischen dem mathematischen Können der beiden Gruppen. Nach einem Jahr testeten die Forscher dann die Fortschritte, die die Kinder beider Gruppen beim Rechnen gemacht hatten. Das Ergebnis war eindeutig: Je mehr die Erstklässler die Mathe-Anwendung benutzten, desto besser wurden auch ihre schulischen Leistungen in Mathe im Vergleich zu den Lese-Kindern. Sie waren ihren Mitschülern am Ende des Jahres in ihrem mathematischen Können um drei Monate voraus. Aber auch eine einmalige Nutzung pro Woche zeigte bereits eine deutliche Auswirkung. Dabei profitieren vor allem die Kinder von Eltern, die normalerweise einen weiten Bogen um Mathe machten.
Zu viele Reize stören beim Lernen
Und doch ist ein bisschen Vorsicht geboten: App ist nicht gleich App, warnt Berkowitz. In dem Experiment nutzten die Familien zum Beispiel eine Anwendung, die bewusst ruhig und unaufgeregt gehalten war. Es wurden kaum Animationen, Musik oder Videos verwendet, sodass die Kinder nicht so leicht abgelenkt wurden und sich entspannen und konzentrieren konnten. Zu viele Reize könnten beim Lernen hinderlich sein. Außerdem legten die Forscher großen Wert auf die Interaktion von Eltern und Kind. Es sei lange bekannt, “dass der Input der Eltern für Kinder, auch gerade wenn es um Mathe geht, sehr wichtig für deren Erfolg auf diesem Gebiet ist“ so Berkowitz. Sprich: Für die kindliche Entwicklung ist es sehr wichtig, zusammen zu überlegen, Probleme zu diskutieren und sich gemeinsam über die richtige Lösung zu freuen.
Haben Gute-Nacht-Geschichten also ausgedient? Keinesfalls. Schon lange ist der positive Effekt des Vorlesens auf die Sprachentwicklung von Kindern bekannt. Doch die Forscher um Berkowitz konnten zeigen, dass auch kleine Veränderungen in der Routine, wie ab und zu eine spielerische Rechenaufgabe, den Kindern helfen können, einen positiven Zugang zu Mathe zu bekommen. Dabei geht es nicht um mehr Hausaufgaben oder Nachhilfe: Die Kinder lernen bei den Knobeleien keinen Schulstoff, sondern Denkmuster und Lösungsansätze - und dass Mathe sogar Spaß machen kann.