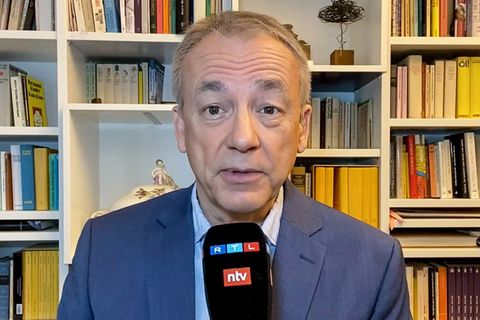Stellen wir uns vor: Ein Ehemann kommt nach Hause, er legt das Notebook auf die Kommode, löst den Knoten seiner Krawatte, auf dem Flur kommt ihm seine Ehefrau entgegen, mit eiskaltem Blick, und schleudert ihm ins Gesicht: "Du bist also fremd gegangen." Was jetzt von Seiten des Ehemanns folgen müsste: Ausflüchte, Schmeicheleien, Ablenkungsmanöver. Doch diese Strategie wäre zwecklos, der Ehemann längst durchschaut: Seine Frau kann Gedanken lesen. Eine Utopie? Fest steht: In aktuellen Experimenten sind Hirnforscher dem Gedankenlesen wieder einen großen Schritt näher gekommen.
"Wir arbeiten derzeit an Versuchen, in denen es darum geht vorherzusagen, wie sich jemand entscheiden wird, bevor er sich entschieden hat", sagt John-Dylan Haynes, Forscher am Berliner Bernstein-Center für Neurowissenschaft. Früher noch als die Probanden selbst wollen die Forscher die Absichten ihrer Probanden erkennen.
Dazu der Versuchsaufbau: Die Probanden wurden in einen Hirnscanner gelegt, ihnen wurden Buchstaben in verschiedener Abfolge gezeigt. Zu einem beliebigen Zeitpunkt sollten sie entweder eine linke oder eine rechte Taste drücken und sich merken, welchen Buchstaben sie sahen, als sie ihre Entscheidung trafen. Das überraschende Ergebnis: Obwohl die Testpersonen das Gefühl hatten, sie hätten sich noch nicht festgelegt, hatte sich ihr Hirn längst entschieden, wann welche Taste gedrückt wird. "Es gibt erste Hinweise darauf, dass das Hirn bereits zehn Sekunden vor Tastendruck aktiv wird", sagt Haynes. - Zehn Sekunden!
Jeder Gedanke bilde ein Gehirnmuster
Wird es irgendwann auch möglich sein, x-beliebige Gedanken zu lesen? Haynes verneint: "Wir können nicht einfach jemanden von der Straße holen, in den Scanner legen und jeden seiner Gedanken sehen, etwa ob er eine Affäre hatte." Der notorische Fremdgeher kann also aufatmen. Möglich sei aber, einfach gestrickte Pläne und Absichten herauszulesen.
Und das funktioniert so: Jeder Gedanke bildet ein unterschiedliches Gehirnmuster. Auch wenn zwei Personen denselben Gedanken haben, ist ihr Muster im Gehirn ein anderes - ähnlich wie Fingerabdrücke sind Gehirnmuster also unverwechselbar. Es bleibt herauszufinden, welche Gedanken mit welchen Gehirnmustern einhergehen und in ein Computerprogramm einzuspeisen. "Dann können wir diese Gedanken feststellen", sagt Haynes.
Das Gehirn beim Lügen beobachten
Doch wem nützen diese Experimente überhaupt? Die Forscher sind weit davon entfernt, das Verfahren massenverfügbar zu machen, nicht nur aus technischen und finanziellen, sondern auch aus ethischen Gründen. Und möchten wir nicht wenigstens unsere innere Welt ganz für uns behalten können? Außer vielleicht, wenn es darum geht, vor Gericht unsere Unschuld zu beweisen. Und genau daran arbeiten Haynes und seine Kollegen. Von den Experimenten erhoffen sie sich unter anderem entscheidende Fortschritte bei der Lügendetektion. "Momentan können die Geräte relativ leicht mit Tricks, die man sich aus dem Internet runterladen kann, überlistet werden", gibt Haynes zu bedenken. "Was derzeit auf dem Markt ist, hält keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand."
Lügendetektoren, so genannte Polygrafen, messen lediglich die - manipulierbare - Erregung nach der Produktion von Lügen, also Änderung von Puls, Atemfrequenz, Blutdruck. Doch warum nicht direkt im Gehirn nachgucken, dort, wo die Lügen hergestellt werden? Machbar wäre das laut Haynes, allerdings erst in ein paar Jahren. Denn: Lügen ist ein komplexerer Vorgang als die Wahrheit zu sagen. Im Hirn werden dabei wesentlich mehr Areale aktiviert.
Steuerung mit der Kraft der Gedanken
Auch in der Medizin gibt es neue Hoffnungen, unter anderem für Querschnittsgelähmte und Parkinson-Patienten: mehr Autonomie, mehr Mobilität - beispielsweise durch Rollstuhl-Steuerung via Gedankenkraft. Geforscht wird an der Durchführung komplexer Abläufe, die beispielsweise der Anweisung folgen: "Fahre mich zu meinem Arzt". Simple Befehle wie "links" oder "rechts" sind ist heute schon möglich, auch Prothesen lassen sich bereits gedanklich steuern.

Wie das funktioniert, zeigen die Experimente des brasilianischen Forschers Miguel Nicolelis. In seinem Labor an der Duke University in Durham, North Carolina, glückte ihm 2003 erstmals folgender Versuch: Ein Rhesusaffe steuerte einen Roboter im Nebenraum - nur durch die Kraft seiner Gedanken. Ein Computer übertrug die Signale des Affenhirns auf die künstlichen Gliedmaßen. Zuvor hatte der Affe den Roboter mit einem Joystick gesteuert und ihn dabei über einen Bildschirm beobachtet. Mittendrin unterbrachen die Forscher den Kontakt des Joysticks zum Computer, lediglich die Nervenzellen im Gehirn blieben mit dem Roboter verbunden. Der Affe begriff allmählich, dass es auch ohne geht, dass der Roboter sich auch bewegte, wenn er dessen Bewegungen nur dachte - er legte den Joystick aus der Hand.
Das Militär ist interessiert
Experimente, die übrigens auch politisches Interesse weckten: Auftraggeber der Forschungen an der Duke University ist das Verteidigungsministerium der USA. Mit einem Etat von 24 Millionen Dollar sollen Software, Elektroden und Computerchips entwickelt werden, um per Gedanken Roboter oder ferngesteuerte Fahrzeuge durch gefährliches, feindliches Terrain zu manövrieren.
Dem Rhesusaffen wurden für das Experiment über 300 Mikroelektroden - der Durchmesser ist geringer als der menschlichen Haares - unter die Schädeldecke eingesetzt. Der Chip für das menschliche Hirn ließ nicht lange auf sich warten: 2004 pflanzten amerikanische Ärzte einen Chip in das Hirn eines Querschnittgelähmten. Der Chip leitete die Signale von hundert Neuronen an einen Rechner weiter. Der Patient war dadurch in der Lage, Computer zu spielen, durch Fernsehprogramme zu schalten und seine E-Mails abzurufen.
Tennisspielen im Wachkoma
Erstaunliches fand auch Adrian Owen von der Universität Cambridge heraus: In aktuellen Experimenten legte der Forscher Wachkoma-Patienten in den Kernspin-Tomografen. Nach außen zeigten die Patienten keinerlei Anzeichen von Bewusstsein. Owen forderte sie trotzdem auf, sich vorzustellen, sie würden Tennis spielen. Kein Zweifel: Sie hörten ihn. Wie sonst ließe sich erklären, dass die Hirnaktivitäten der Wachkoma-Patienten identisch waren mit den Hirnaktivitäten gesunder Kontrollpersonen, die in Gedanken Tennis spielten? Allerdings nur ein Teilsieg für Owen - nicht alle Wachkoma-Patienten reagierten auf seine Ansprache.
Das menschliche Gehirn besteht aus rund 100 Milliarden Neuronen, auf jedem Quadratmillimeter Hirnrinde sitzen 100.000 Nervenzellen, sie sind mit etwa 1000 ihrer Nachbarn verbunden. Das Experimentierfeld ist also noch lange nicht beackert, man hat erst angefangen zu graben. Vielleicht wird es für Alltags-Lügenbarone doch noch mal richtig eng.