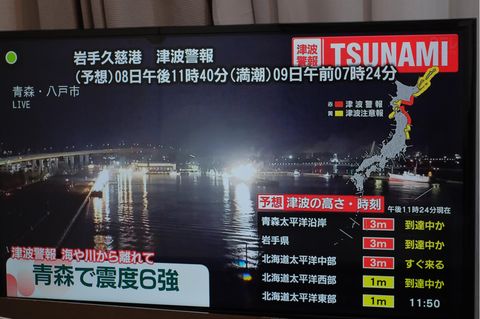Es war ja wirklich etwas seltsam vergangene Woche. In Japan irrten Menschen ohne Heim und Hilfe durch Landschaften, die wie geschreddert aussahen, und stellten sich ohne jedes Anzeichen von Ungeduld stundenlang in eine Warteschlange, um sich mit Wasser und dem Nötigsten fürs Leben versorgen zu lassen. Gleichzeitig sorgten sich in Deutschland Menschen, ob sie wegen der Radioaktivität aus japanischen Katastrophenreaktoren weiter Fischstäbchen oder Shiitake-Pilze essen könnten. Geigerzähler waren ausverkauft, Jodtabletten wurden gebunkert. Verfolgte man die Medien, konnte durchaus der Eindruck entstehen, die gravierendsten Probleme gäbe es hier bei uns, nicht im fernen Japan.
Einem Niederländer, der seit vergangenem Jahr mit seiner deutschen Freundin in Hamburg lebt und auch schon einiges von der Welt gesehen hat, war das alles wohl so fremd, dass er sich an stern.de wandte und uns seine Beobachtungen beschrieb. Seine Mail kreiste um eine wirklich ernst gemeinte Frage und war keine Anklage. Auch gebildete, intelligente und auf den ersten Blick emotional ausgeglichene Menschen redeten bei uns gern über alles, was schief gehen könnte, so war unserem Neubürger aufgefallen. Offenbar beherrsche Angst fast das ganze Leben in Deutschland. Da ist was dran, wenn wir ehrlich sind. Im Ausland wird dieser Wesenszug gern als "German Angst" verspottet, doch dass die Deutschen mit ihrer manchmal übertriebenen Angst vor der Gegenwart und mehr noch vor der Zukunft allein stünden, ist schlicht nicht wahr. Vielleicht äußert sie sich nur anders als anderswo.
Frank Ochmann
Der Physiker und Theologe verbindet als stern-Redakteur natur- und geisteswissenschaftliche Interessen und befasst sich besonders mit Fragen der Psychologie und Hirnforschung. Mehr auf seiner Homepage.
Während wir uns hierzulande gerade wieder mit der Radioaktivität herumschlagen und vielleicht auch noch mit Misstrauen auf den Euro in der Tasche blicken, plagt die Amerikaner das diffuse, aber wachsende Gefühl, den globalen Glanz ihrer Nation ermatten zu sehen. Die Angst vor der Evolutionstheorie und womöglich ansteckendem Schwulsein, vor Milzbrand vom Terroristen und einem 2012 anstehenden Weltenende nach dem Mayakalender kommen bei etlichen noch obendrauf. Schweizer wiederum – und auch einige Niederländer, wenn ich das richtig sehe – haben derzeit zum Beispiel Angst vor der Überfremdung und vor allzu hohen Minaretten an den Moscheen.
Als schließlich 1996 der Öltanker "Sea Empress" vor Wales auf Felsen lief und im Laufe der folgenden Woche 200 Kilometer Küstenlinie mit Tausenden von Tonnen Öl aus dem Schiff verdreckt wurden, gab es unter den Anwohnern deutliche Krankheitssymptome: Übelkeit, Kopfschmerzen, Hautausschläge. Allerdings meldeten sich viele schon bei ihren Ärzten, als das Öl noch gar nicht ausgelaufen war. Die ersten Fernsehnachrichten über das Unglück hatten schon gereicht, um die Leiden auszulösen.
Allgegenwärtiges Massenphänomen
Diese Liste ließe sich im globalen Maßstab verlängern. Vielleicht stimmt es ja, dass wir zwischen Ostsee und Alpen eher vorsichtig als wagemutig sind und darum das sprichwörtliche Glas auch eher halb leer als halb voll sehen. Doch mit schwer greifbaren Ängsten sind wir keinesfalls allein auf der Welt. Richtig ist vielmehr, dass die Paranoia – "das neben dem Verstand stehen" – grassiert. Weil aber Ängste immer echte Ängste mit den entsprechenden Reaktionen in Kopf und Körper sind, auch wenn es keinen nachweisbaren äußeren Grund für sie gibt, sollten sie nicht belächelt werden. Selbst in der Forschung wurde das Thema lange nicht sonderlich ernst genommen. Zumindest galt die Paranoia fast immer als ein Hinweis auf etwas anderes, eine Schizophrenie vielleicht.
Wenn es jetzt erste Untersuchungen über die Paranoia als eigenständiges Phänomen gibt, dann wird damit späte Pionierarbeit geleistet. Die faktisch unbegründete oder zumindest übersteigerte Angst ist jedenfalls ein Massenphänomen. Sie ist so allgegenwärtig, glauben Forscher wie Daniel Freeman vom King's College London, dass die Vorstellung, man könne sie mit ein bisschen Nüchternheit und passenden Gegenmaßnahmen wieder loswerden, so unrealistisch ist wie die Hoffnung, Traurigkeit oder Stress ließen sich aus dem Leben der Menschen verbannen. Wir werden auch weiter mit solchen Ängsten leben müssen, heißt das. Trotzdem müssen wir uns ihnen nicht einfach ergeben.
Keine Angst vor der Angst
Angst ist als Gefühl nicht angenehm, aber notwendig im wahrsten Sinn dieses Wortes. Angst hilft uns, Gefahren und Bedrohungen zu erkennen und gibt uns somit die Chance, rechtzeitig etwas dagegen zu tun. Angstfrei leben zu wollen wäre also ziemlich töricht. Und kommt das Gefühl auf, wissen wir selten sofort, ob es begründet ist oder auf einen falschen Alarm zurückgeht. Wie es sich tatsächlich verhält, lernen wir immer erst danach. Dieser Prozess aber kann helfen. Schauen wir ein bisschen genauer hin, was uns Angst macht und wann und wo sie aufkommt, entdecken wir vielleicht auch, wo sie nicht ganz so nötig ist, wie es im ersten Moment scheint. Fakten sind kein schlechtes Gegenmittel. Es sind oft die schwer begreifbaren, nicht sofort wahrnehmbaren Phänomene wie Strahlen oder unsichtbare Gifte, die uns in Angst versetzen.
Es hilft, sich damit auseinanderzusetzen und schlicht etwas über Strahlen oder Gifte zu lernen. Was ich weiß, kann ich einschätzen und einigermaßen selbstständig beurteilen. Ich falle dann auch nicht mehr auf jede Übertreibung herein, die zu lesen oder zu hören ist. Das Beispiel vom Tankerunglück in Wales zeigt, wie stark uns das wilde Getrommel der Medien beeinflussen und auch verängstigen kann. Den medialen Heißluftgebläsen in solchen Fällen ausweichen zu können, schützt vor unnötigen Ängsten und stärkt nachweislich auch das Selbstbewusstsein. Dem kommt es auch zugute, wenn wir uns nicht ständig in die Rolle des durch und durch vernünftigen, alles kontrollierenden Menschen zwängen. Wir können uns darin nicht wohlfühlen, denn so sind wir einfach nicht. Evolutionsgeschichtlich haben wir uns anders entwickelt. Es gibt keine emotionsfreien Momente in unserem Leben, und selten nur ist die Vernunft der tragende Pfeiler unseres Verhaltens. Ein bisschen mehr Einsicht in die Fakten hilft auch in diesem Fall und stimmt gelassen. Und dann brauchen wir auch vor der Angst keine Angst mehr zu haben.
Literatur:
- Corr, P. J. 2011: Anxiety: Splitting the phenomenological atom. Personality and Individual Differences 50, 889–897
- Freeman, D. & Freeman, J. 2008: Paranoia – The Twenty-First Century Fear. Oxford: Oxford University Press
- Neuberg, S. L. et al. 2010: Human Threat Management Systems: Self-Protection and Disease Avoidance. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 35, 1042-1051
- Rimé, B. 2009: Emotion Elicits the Social Sharing of Emotion: Theory and Empirical Review. Emotion Review 1, 60-85