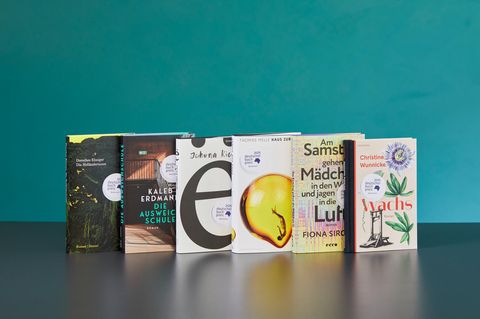Herr Scheithauer, gibt es ein typisches Amokläufer-Profil?
Das ist eine schwierige Frage. Im Berliner Leaking-Projekt beschäftigen wir uns mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung verschiedener Fälle. Wenn wir rückblickend schauen, finden wir tatsächlich Merkmale, die sich bei allen Tätern ähneln und gehäuft auftreten. Allerdings ist es nicht so, dass Personen, die alle diese Merkmale aufweisen, automatisch Amokläufer werden.
Welche Merkmale sind das?
Meistens drohten Amokläufer vorher mit ihrer Tat. Oder die Fantasie des Täters hat sich in Form von Bildern oder einem martialischen Auftreten geäußert - im Fall Emsdetten hat sich der Täter beispielsweise vorher selbst immer wieder mit Waffen in Pose gesetzt.
Ein so genannter Amoklauf ist oft auch kein wirklicher Amoklauf, sondern eine wohl geplante Tat. Oft werden Tatvorbereitungen getroffen. Es besteht ein gesteigertes Interesse an Waffen, speziell Schusswaffen. Sehr häufig erlebt sich der Täter als Opfer, macht andere für seine Situation verantwortlich. Viele Täter sind sozial wenig integriert, haben kaum Freunde, besitzen geringe soziale Kompetenzen und Problemlösungsfähigkeiten, können schlecht mit Stress umgehen. Häufig beobachtet man im Vorfeld psychische Auffälligkeiten bis hin zu aggressivem Verhalten.
Das "Berliner Leaking-Projekt"
Herbert Scheithauer ist Entwicklungspsychologe an der Freien Universität Berlin und leitet das "Berliner Leaking-Projekt". In diesem Rahmen untersucht er Amokläufe. Ziel ist es, Erkennungsmerkmale zu identifizieren, anhand derer Gewalttaten im Vorfeld verhindert werden können.
Scheithauer und seine Kollegen wollen außerdem in Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin ein Kommunikationssystem entwickeln, das es den Schulen ermöglicht, kritische Vorfälle, akute Bedrohungslagen oder auch einen bloßen Verdacht berichten zu können, sodass schnell und effizient Hilfe vor Ort ist.
Kann man daraus nicht ein Früherkennungs-Warnmuster ableiten, damit solche Fälle verhindert werden können?
Das ist das langfristige Ziel, in unserem Projekt schauen wir uns sogenannte Leaking-Merkmale an (leaking engl. = tröpfeln, Leckschlagen, d. Red.) - also Hinweise, von denen aus im Vorfeld auf einen möglichen Täter geschlossen werden kann. Außerdem wollen wir herausfinden, wie häufig Amokdrohungen im Schulalltag vorkommen. Möglicherweise ist das ein Indikator, dass Lehrer an starken Änderungen der Verhaltensweisen - beispielsweise an gesteigertem Interesse eines Schülers an Amokläufen oder an Waffen - einen potenziellen Amokläufer erkennen. In fast allen Fällen gab es im Vorfeld Ankündigungen - man hätte sie verhindern können, wenn man die Warnsignale erkannt und ernst genommen hätte.
Dieser Täter war 23 Jahre alt. Es fällt auf, dass solche Amokläufe vorwiegend von Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern ausgeführt werden. Gibt es ein kritisches Zeitfenster für Amokläufe?
Wir haben schon Fälle gehabt, wo 13-Jährige beteiligt waren, also noch halbe Kinder. Aber es gibt auch ältere Personen, die als ehemaliger Schüler einer Schule solch eine Tat begehen. Es stimmt, Amokläufe kommen gehäuft im Jugendalter vor. Mir ist auch kein einziger Vorfall mit Mädchenbeteiligung bekannt.
Jungen in einem gewissen Alter identifizieren sich mit gewissen Dingen in ihrer männlichen Rollenentwicklung. Oder sie haben möglicherweise große Schwierigkeiten ihre normale Entwicklung zu durchlaufen. Diese Jugendlichen wollen vielleicht besonders populär in einer gleichaltrigen Gruppe sein, wollen Annerkennung, in einer Clique sein - aber es gelingt ihnen nicht so wie anderen. Das kann schnell zu Verzweiflung führen und dann suchen sie sich Nischen. Das kann der Versuch sein, sich durch besonders bizarres Auftreten oder die Betonung der eigenen Opferrolle zu profilieren. Oder die Identifikation mit einer sehr starken Rolle, hier kommt dann der Waffenbesitz ins Spiel.
Können Sie das altersmäßig eingrenzen?
Wir haben in Deutschland Fälle gehabt mit Tätern zwischen 14 und 22 Jahren. International gab es auch schon Fälle mit 13-Jährigen. Alarmierend ist, dass wir auch schon Leaking-Dokumente von einem 10-Jährigen gefunden haben, der seine Klasse vor einer Tat gewarnt hat. Das muss nicht gleich in einem Amoklauf enden, aber das kann sich in eine Richtung entwickeln, vor der wir diese Jugendlichen und Kinder und ihr Umfeld rechtzeitig bewahren müssen.
Erhöht sich durch den Besitz einer Waffe die Wahrscheinlichkeit eines Amoklaufs?
Nein. Man kann nicht pauschal sagen, dass, wenn ein Jugendlicher eine Waffe besitzt, er sie auch verwendet oder gar zum Amokläufer wird. Wir wissen aus Befragungen, dass viele Schüler selbst angeben, Waffen mit in die Schule zu nehmen. Auch, wenn das vielleicht gar nicht stimmen mag, zeigt es aber, dass Waffen auf Jungen in einem gewissen Alter eine Faszination ausüben, weil sie Stärke demonstrieren. Sie mögen sogar schon einen modischen Stellenwert besitzen, mit dem sich Jugendliche einfach brüsten. Ganz einfach, weil es dazugehört, eine Waffe, zum Beispiel ein Messer, dabei zu haben.
Doch die Gefahr liegt vielleicht gar nicht unbedingt darin, dass der Jugendliche die Waffe selbst besitzt. Es kann auch sein, dass der Vater sie zuhause im Waffenschrank stehen hat. Wir haben einige dokumentierte Fälle, in denen die Tatwaffe aus der Familie des Täters stammte.
Können Amokläufe durch eine Verschärfung der Waffengesetze verhindert werden?
Nein, das glaube ich nicht. Nach Erfurt wurden hierzulande die Waffengesetze verschärft und dennoch ist es danach zu weiteren Amokläufen gekommen. Ein Verbot von Waffen, zum Beispiel in den USA, vermindert sicherlich die vielen tödlichen Unfälle mit Schusswaffen - aber Amokläufe wird es dennoch geben. Durch Verbote werden Jugendliche vielleicht nur zusätzlich animiert, Waffen zu besitzen. Ebenso wenig bringt ein nationales Verbot gewalttätiger Spiele. Die Jugendlichen, die das faszinierend finden, werden sich diese Spiele immer irgendwie besorgen.
Was ist Ihrer Meinung nach zu tun?
Wir wissen noch immer zu wenig über Amokläufer - wir haben noch nicht das Patentrezept. Wir müssen uns vorbereiten, brauchen Notfallpläne und geschultes Personal. Wir müssen Kommunikationswege schaffen, dass ein Anruf bei der Polizei umgehend bei einem Ansprechpartner landet, der sich mit solchen Situationen auskennt und so schnell wie möglich Hilfe vor Ort ist.
Dann brauchen wir Aufklärung. Keine Hysterie und keine Stigmatisierung, sondern Aufklärung über Merkmale, die darauf hindeuten, dass sich ein Schüler in einer sehr problematischen Situation befindet und dann Hilfe in Anspruch nehmen kann. Wir brauchen ausgebildete Fachkräfte bei schulpsychologischen Diensten, die Lehrer unterstützen können. Ich setze eher auf Kompetenzförderung als auf schnell geforderte Verbote.