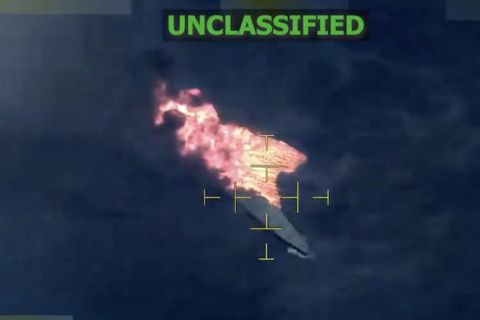Von erbosten Studentenmüttern per E-Mail als Schande für seine Universität beschimpft zu werden gehört nicht gerade zum Arbeitsalltag eines hoch angesehenen Ordinarius mit Stiftungslehrstuhl. Auslöser für die elterliche Wut auf den Pharmakologie-Professor David Nichols von der Purdue-Universität in Indiana: ein Artikel im "Wall Street Journal", der ihn als Geburtshelfer einer neuen Drogengeneration beschreibt, die Suchtexperten zunehmend Sorgen bereitet.
Als Legal Highs werden die Designerwirkstoffe über das Internet angeboten - von Herstellern, die sich ihre Rezepte aus der chemischen Forschungsliteratur zusammenklauben. Die Händler nutzen eine rechtliche Grauzone aus. Die meisten Substanzen sind so neu, dass Gesetzgeber und Ermittler sie nicht kennen, geschweige denn in Blut, Haaren oder Urin nachweisen können. Dazu kommt, dass Händler die Substanzen als Räucheröl, Pflanzendünger oder Badesalz anpreisen - und darauf hinweisen, dass sie für den menschlichen Verzehr nicht geeignet seien. Immerhin das stimmt: Erst im Dezember warnte das Bundeskriminalamt vor Nebenwirkungen wie Kreislaufversagen, Psychosen oder Nierenversagen.
Gefunden in ...
... der "Financial Times Deutschland"
Besonders hilfreich bei der Herstellung neuer Drogen, erklärt der schottische Legal-High-Händler David Llewelyn im "Wall Street Journal", seien die Veröffentlichungen von Nichols. Seit 40 Jahren erforscht der Chemiker die Wirkung von Botenstoffen und anderen Chemikalien auf das Gehirn - darunter auch bewusstseinserweiternde Substanzen wie LSD. Dafür hat er 1993 sogar ein privates Forschungsinstitut mitgegründet. Ein aktuelles Projekt: die Behandlung von Krebspatienten im Endstadium mit der Pilzdroge Psilocybin.
Dabei ist Nichols kein Rausch-Apologet wie der Psychologe Timothy Leary, der in den 60er-Jahren Sträflinge mit Psilocybin-Trips resozialisieren wollte und den LSD-Slogan "Turn on, Tune in, Drop out" prägte. Der 66-Jährige sucht nach Wirkstoffen, die bei Nervenleiden und psychischen Störungen helfen.
"Ich war geschockt"
So forscht Nichols seit 1982 an Substanzen, die der Droge Ecstasy ähneln - die damals in der Psychotherapie verwendet wurde. Nichols entdeckt im Tierversuch, dass ein ähnlicher Wirkstoff namens MTA gegen Depressionen helfen könnte, und schreibt bis 1997 mehrere Artikel darüber. Dass Drogendesigner seine Arbeiten lesen und MTA nachbauen, erfährt er erst 2002. Da sind schon sechs Menschen an Flatliners, wie die Pillen in der Szene heißen, gestorben.
"Ich war geschockt, danach fühlte ich mich lange depressiv und leer", schreibt der Chemiker jetzt in der Fachzeitschrift "Nature". Dass die Substanz ausdrücklich nur an Tieren getestet worden war, dass man bei genauer Lektüre die Gefahr hätte erkennen können, sei ihm kein Trost: "Ich hatte Informationen veröffentlicht, die letztendlich zum Tod von Menschen geführt haben."
Inzwischen lebe er in ständiger Angst davor, dass Millionen Menschen einer neuen, scheinbar harmlosen Droge zum Opfer fallen. Verzichten will er auf Veröffentlichungen aber nicht: "Man weiß vorher nie, an welcher Stelle Forschungsergebnisse nützlich sein können." Nur einmal sei ihm eine Substanz so gefährlich erschienen, dass er sie begraben habe.
Inzwischen bitten regelmäßig Behörden um seine Hilfe beim Nachweis neuer Drogen. 31 wurden in Europa 2010 entdeckt - 2009 waren es 24. Wie viele Kandidaten stecken insgesamt in der Literatur? "Ich schätze, etwa 100."