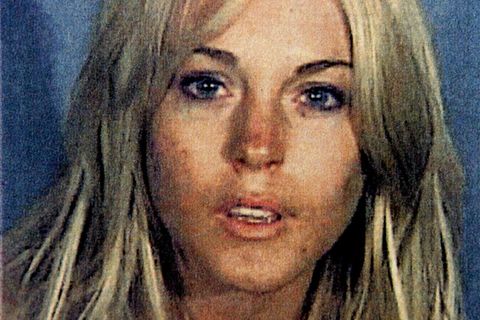Herr Professor Sachser, warum fällt es uns allen so schwer, in sozialen Medien einfach weiter zu switchen, sobald Bilder von süßen Tierbabys auftauchen?
Recht sicher, weil das "Kindchenschema" auf uns wirkt – dagegen sind wir nahezu machtlos. Die Verhaltensforscher und späteren Nobelpreisträger Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen haben in den 1930er-Jahren entdeckt, dass es im Tierreich angeborene Auslösemechanismen gibt, etwa beim Stichling. Die Männchen verteidigen in der Fortpflanzungszeit ihre Territorien aggressiv gegenüber anderen Männchen, und man konnte an diesem Modellsystem gut erforschen, warum das so ist.
Der Stichling, das ist ein Fisch, nicht wahr?
Ja. Die rote Bauchunterseite eines Eindringlings stellt einen Schlüsselreiz dar, der ein instinktives Verhalten beim Inhaber des Territoriums auslöst. Sobald der irgendetwas mit roter Unterseite erkennt, sei es ein Stück Holz, das man rot angemalt hat, greift er an. Während er eine Attrappe, die exakt einem Stichling-Männchen gleicht, aber bei der man die Bauchunterseite nicht rot färbt, ignoriert. Das interessiert ihn nicht einmal.

Zur Person
Norbert Sachser, geboren 1954, ist Professor für Zoologie und leitet das Zentrum für Verhaltensbiologie an der Universität Münster. Er gilt als bedeutendster deutscher Verhaltensbiologe mit internationalem Ruf. Unter anderem war er Präsident der Ethologischen Gesellschaft, deren Ehrenmitglied er heute ist. Seine Forschung beschäftigt sich mit der Evolution und Entwicklung des Sozialverhaltens von Säugetieren und geht aktuell der Frage nach, wie sich Umwelt- und genetische Faktoren gegenseitig beeinflussen. Sein Buch "Der Mensch im Tier" wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Was hat das mit unserem Internet-Verhalten zu tun?
Konrad Lorenz fragte sich in den 1940er-Jahren, ob es nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen angeborene Auslösemechanismen geben könnte und entwickelte das Konzept des Kindchenschemas. Er ging davon aus, dass bestimmte Merkmale, die wir vor allem bei Babys vorfinden – nämlich einen im Vergleich zum Körper großen Kopf, große Augen, hohe Stirn, eine kleine Stupsnase, Pausbacken – wie ein Schlüsselreiz wirken und automatisch eine positive Gefühlstönung hervorrufen. Wir sagen dann spontan "Oh wie süß" und möchten uns um das Wesen mit diesen Merkmalen kümmern. Auch tapsige Bewegungen und eine rundliche Körpergestalt können zum Kindchenschema beitragen. Wie hervorragend dieses Konzept beim Menschen funktioniert, zeigt uns die Werbeindustrie, die ständig mit dem Kindchenschema arbeitet.
Es hat schon seinen Grund, weshalb beim WWF ein Panda im Logo ist und keine gefährdete Viper"
Ein umstrittenes Thema, oft werden für Werbeclips eigens dicke Babys gecastet, weil diese besser ankommen.
Dabei brauchen Sie nicht wirklich ein Kleinkind, um die Reaktionen auf das Kindchenschema auszulösen. Das ist wie mit dem rotangemalten Holzstück beim Stichling. Der Auslösemechanismus funktioniert auch bei fiktiven Filmwesen wie Micky Maus oder Nemo, klassischerweise beim Teddybären. Nicht einmal der World Wildlife Fund kommt ohne aus. Es hat schon seinen Grund, weshalb da ein Panda im Logo ist und keine gefährdete Viper. Selbst bei Autos funktioniert das Kindchenschema.
Wir finden deswegen sogar Autos putzig?
Autos, die Merkmale des Kindchenschemas erfüllen. Denken Sie an den Beetle oder den Cinquecento. Die sehen nicht unabsichtlich so niedlich aus, rundlich mit Vorderleuchten wie große Kulleraugen. Auch Roboter kommen wesentlich besser an und sind einfacher zu verkaufen, wenn sie Merkmale des Kindchenschemas aufweisen und große Augen haben.
Sie waren an zwei klassischen Studien zum Kindchenschema beteiligt, die 2009 veröffentlicht wurden. Wie lief die Forschung, was wurde herausgefunden?
Damals führte meine Doktorandin Melanie Glocker eingebunden in ein internationales Team aus Verhaltensbiologen und Neurowissenschaftlern eine bemerkenswerte Studie durch. In einem ersten Schritt wurden 17 Babyfotos genommen und diese mittels einer Morphing-Software säuberlich manipuliert. Einmal haben wir die Merkmale im Sinne des Kindchenschemas verstärkt, ein anderes Mal abgeschwächt, sodass von jedem Bild drei Varianten existierten. Diese 51 Fotos wurden Studierenden in Philadelphia in zufälliger Reihenfolge gezeigt, und sie sollten spontan auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, wie niedlich sie das Baby finden und wie gern sie sich um es kümmern möchten. Wenn Sie die Augen vergrößern, die Stirn höher machen, den Mund etwas kleiner, werden die Babys sofort als noch niedlicher empfunden und umgekehrt. Wir waren auch daran interessiert, ob es einen geschlechtsspezifischen Effekt gibt. Wenn wir die Merkmale des Kindchenschemas verstärkten, fanden sowohl männliche als auch weibliche Studierende die Fotos niedlicher. Aber nur die Studentinnen gaben an, dann auch stärker motiviert zu sein, sich um das Baby kümmern. Ein stärker ausgeprägtes Kindchenschema rief also nur bei den Studentinnen eine höhere Pflegemotivation hervor.
Was passiert da im Hirn?
Als Konrad Lorenz das Kindchenschema entwickelte, war nicht klar, was bei seiner Betrachtung im Gehirn geschieht. Heute wissen wir, dass das so genannte mesolimbische Belohnungssystem eine wesentliche Rolle spielt. Dieses System kommt bei allen Säugetieren vor und umfasst Teile des Mesencephalons, also des Mittelhirns und des limbischen Systems. Insbesondere ein beteiligtes Kerngebiet, der Nucleus accumbens, ist entscheidend dafür, dass das Betrachten des Kindchenschemas zu positiven Gefühlen führt.
Vergleichbare Prozesse spielen sich auch im Gehirn ab, wenn Sie einem Alkoholiker eine Whiskeyflasche unter die Nase halten"
… jetzt wird's ein bisschen sehr wissenschaftlich.
Man muss sich das so vorstellen: Dieses System beinhaltet sogenannte dopaminerge Neuronen, das sind Nervenzellen, die Dopamin als Botenstoff verwenden. Wenn unsere Augen nun Merkmale des Kindchenschemas erblicken, wird dieser optische Reiz ins Gehirn weitergeleitet und durch das mesolimbische Belohnungssystem bewertet. Es kommt zu einer starken Aktivierung des Nucleus accumbens, das heißt: Dopamin wird ausgeschüttet und bindet an Rezeptoren. Dieser Vorgang ruft ein Belohnungsgefühl hervor, ein Bestätigungsgefühl, ein positives Empfinden, ein Glücksgefühl. Vergleichbare Prozesse spielen sich übrigens auch im Gehirn ab, wenn Sie einem Alkoholiker eine Whiskeyflasche unter die Nase halten.
Konnten Sie all das wissenschaftlich nachweisen?
Ja, wir haben bei einigen Studierenden in Philadelphia auch eine funktionelle Magnetresonanztomografie durchgeführt, wie man das auch aus der Medizin kennt. So konnten wir beobachten, welche Gehirnareale aktiviert werden, durch den Anblick der bearbeiteten Fotos. Wir konnten nachweisen, dass die Verstärkung des Kindchenschemas zu einer deutlich erhöhten Aktivität des Nucleus accumbens führt. Das war damals sehr spektakulär, denn es war uns gelungen, den neurophysiologischen Mechanismus nachzuweisen, warum das Kindchenschema funktioniert.
Wurden bisher nur Bilder menschlicher Babys getestet?
Andere Forschungsgruppen haben – ganz ähnlich wie wir mit den Babyfotos – mittlerweile auch Bilder von Hunden und Katzen manipuliert und diese dann Kleinkindern gezeigt. Da ging es darum, wie lange blicken die auf welches Bild. Auch hier fanden die Kinder Bilder spannender, bei denen die Kindchenschema-Merkmale verstärkt worden sind.
Hat uns das die Natur mitgegeben, unseren Nachwuchs und den anderer so unendlich süß zu finden, dass wir ihm Pflege widerfahren lassen?
Ob das, wie Konrad Lorenz glaubte, angeboren ist, lässt sich bei Menschen schwer nachweisen. Dass bereits vier Monate alte Babys auf das Kindchenschema reagieren, deutet darauf hin, ebenso wie Untersuchungen mit drei bis sechs Jahre alten Kindern. In Jäger- und Sammler-Gemeinschaften haben Kinder mit diesen Merkmalen sicher besser überlebt, weil sie es auch geschafft haben, die Aufmerksamkeit von nicht Verwandten zu gewinnen und auch deren Pflegemotivation zu aktivieren. Das war ein klarer Überlebensvorteil. Es gibt Daten, die zeigen, dass in der Zeit von 500 vor Christus bis 1950 etwa ein Viertel aller Neugeborenen vor Vollendung des ersten Lebensjahres starben. Vermutlich war die Kindersterblichkeit in der Steinzeit sogar noch höher. Kinder konnten nur überleben, wenn sich die Gruppe gemeinschaftlich um sie gekümmert hat.
Wie kann es dann geschehen, dass Menschen gegenüber Babys oder Welpen grausam sind?
Jede instinktive Reaktion, ob bei Menschen oder Tieren, kann kulturell überformt werden. Gehen wir noch einmal zurück in die Verhaltensforschung, da gibt es das berühmte Beispiel der Silbermöwen: Hungrige Küken picken angeborenermaßen auf einen roten Fleck auf dem gelben Schnabel der Mutter, woraufhin sie gefüttert werden. Zeigt man einem unerfahrenen Küken eine Schnabelattrappe aus Pappe oder Holz mit Flecken unterschiedlicher Farbe, so bevorzugen sie instinktiv Rot und meiden Blau. Wenn jedoch die Reaktionen auf Blau belohnt wird und die auf Rot nicht, dann ändert sich diese Vorliebe rasch.
Beim Menschen ist es ähnlich. Selbst wenn dieser neurophysiologische Mechanismus funktioniert, wie wir ihn gezeigt haben, heißt das nicht, dass er bei allen Menschen immer funktioniert. Es gibt eben Menschen, die das Kindchenschema überhaupt nicht entzückt, weil sie vielleicht entsprechende Erfahrungen gemacht haben oder in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem das nicht honoriert wurde beziehungsweise das Gegenteil davon. Kulturelle Einflüsse spielen beim Menschen immer eine Rolle. Wie wir auf Außenreize reagieren, entsteht aus der komplexen Interaktion zwischen genetischer Prädisposition, Sozialisation, Umwelteinflüssen und Erfahrungen.
Sprechen Hunde und Katzen auch auf das Kindchenschema an? Wird bei ihnen ebenfalls eine positive Gefühlstönung ausgelöst, wenn sie ein Menschenbaby sehen?
Das wissen wir nicht, auch nicht, ob sie auf das Kindchenschema ansprechen, wenn es bei ihrem eigenen Nachwuchs auftritt. Dazu gibt es bei Säugetieren erstaunlich wenige systematische Untersuchungen. Klar ist, dass viele Tierbabys Merkmale des Kindchenschemas aufweisen, aber ob sie deshalb einen Selektionsvorteil haben, ist schwer zu sagen.
Hundewelpen, die ausgeprägte Kindchenschema-Merkmale haben, verbringen sehr viel kürzere Zeit im Tierheim"
Nicht einmal bei der engsten Verwandtschaft, also den Menschenaffen?
Wir wissen es schlichtweg nicht, die Datenlage ist zu dünn. Die Babys der Menschenaffen haben recht offensichtlich die Merkmale des Kindchenschemas, aber ob es bei deren Eltern eine entsprechende Gefühlstönung auslöst, es deshalb mehr Pflege bekommt und besser überlebt, ist unbekannt. Es gibt eine Studie über Schimpansen, in der nicht die typischen Kindchenschema-Merkmale ein besonderes Interesse der Erwachsenen auslösen, sondern die Gesichtsfärbung. Lassen Sie uns das Augenmerk auf so genannte "Companion Animals" legen wie Hund und Katze. Bei ihnen gibt es tatsächlich Hinweise darauf. Hundewelpen, die ausgeprägte Kindchenschema-Merkmale haben, verbringen sehr viel kürzere Zeit im Tierheim und werden schneller adoptiert. Menschen finden Welpen laut Umfragen am attraktivsten, wenn diese sich in der Entwöhnungsphase befinden. Also genau zu jenem Zeitpunkt, zu dem es darauf ankommt, was mit dem Welpen geschieht. Wahrscheinlich ist es im Laufe der Domestikation dazu gekommen, dass Menschen genau in jenem Moment am stärksten für einen kleinen Hund sorgen möchten, wenn dieser es auch braucht.
Wir finden allerdings alle möglichen Tierbabys süß, das Löwenkind oder das Nashornbaby hat wenig davon, dass sein Anblick Menschen rührt.
Das ist ein wichtiger Punkt. Tiere können Kindchenschema-Merkmale aus völlig unterschiedlichen Gründen haben, und sie treten auch keineswegs nur bei Tierkindern auf. So haben Rehe nicht etwa große Augen, um beim Menschen Entzücken hervorzurufen, sondern weil sie damit in der Dämmerung besser sehen können. Und denken Sie an den Pandabären, der diese Merkmale nicht nur als Junges hat, sondern immer. Und deshalb zur Werbeikone wurde.
Wenn in Zoos besonders niedliche Tierkinder zur Welt kommen, schlägt das Kindchenschema mit seiner marktwirtschaftlichen Verkettung oft in Massenpsychose um. Stichwort: Eisbär Knut. Österreich erlebt gerade Ähnliches mit seinem allersten Gorillababy. Wie blicken Sie als Wissenschaftler auf so einen Hype?
Das Kindchenschema allein bringt keinen Hype hervor, ein solcher wird von Menschen inszeniert. Vielleicht haben wir Menschen noch immer eine genetische Veranlagung dafür, uns für die Natur zu interessieren, für Tiere, für Pflanzen. Dies wird als Biophilie bezeichnet. Für unsere Vorfahren war das sicher wichtig. Es scheint zudem beim Menschen ein Bedürfnis nach kollektivem Erleben zu geben, das kann übrigens auch Trauer sein.
Ob Walross Antje oder der Tod von Prinzessin Diana, es gibt das Bedürfnis gemeinschaftlich zu fühlen, nach dem kollektiven Erlebnis"
Wie 2003, als die Menschen im Tierpark Hagenbeck wochenlang von der sterbenden Walross-Ikone Antje Abschied nahmen?
Ob Walross Antje oder der Tod von Prinzessin Diana, es gibt das Bedürfnis gemeinschaftlich zu fühlen, nach dem kollektiven Erlebnis. Ein Hype, wie bei Eisbär Knut entsteht, wenn mehrere Faktoren zusammen kommen: ein Wesen mit Kindchenschema, Biophilie, das Bedürfnis nach kollektivem Erleben und last but not least eine professionelle Vermarktungsstrategie.

Ist das gut oder schlecht?
Wie so oft, beides. Die Botschaften in meinem Buch "Der Mensch im Tier" lautet: Wir sind den Tieren näher gerückt. Es steckt viel mehr Mensch im Tier, als wir uns vor wenigen Jahren haben vorstellen können.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch: Trotz aller Ähnlichkeiten mit uns können wir nicht einfach vom Menschen auf andere Arten schließen. Wir dürfen die Tiere nicht vermenschlichen. Aber genau das passiert allzu oft in jenen Hypes, die Leute sagen: Guck mal, die sind wie wir! Diese Anthropomorphisierung ist aber extrem schädlich. Kein Hund ist ein kleiner Mensch mit Fell. Und kein Gorillababy ist wie ein Menschenkind. Jedes Tier hat seine artspezifischen und individuellen Bedürfnisse und Eigenarten, wer das missachtet, tut dem Tier nichts Gutes.
Der Zoo in Österreich kann die große Aufmerksamkeit, die ihm durch die Geburt des Gorillababys zuteil wird, jetzt aber auch nutzen, um medienwirksam auf die Bedrohung der Gorillas und den Verlust ihres Lebensraums hinzuweisen. Und er kann in diesem Zusammenhang für eine der größten Herausforderungen sensibilisieren, der sich die Menschheit gegenübersieht: einem Artensterben von gigantischem Ausmaß.
Wenn Zoos die Liebe der Menschen zu Tieren fördern, um auf deren Gefährdung aufmerksam zu machen, dann ist das eine gute Sache
Das Gorilla-Baby in Österreich wurde von der Bevölkerung inzwischen getauft, es heißt Jabari. Würden Sie empfehlen, einem Tier Namen zu geben?
Tiere sind Individuen, das lässt sich gerade Kindern dadurch vermitteln, dass sie ihnen Namen geben. Insofern habe ich nichts gegen eine Namensgebung einzuwenden. Aber wenn eine Vermarktung wie bei Knut passiert, fehlt mir das Verständnis dafür. Meine Vision von modernen Zoos ist, dass da nur sehr wenige Tierarten exzellent gehalten werden und es parallel zu jeder Tierart auch ein Naturschutzprojekt im natürlichen Lebensraum der Tiere gibt. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte der Berliner Zoo noch damit geworben, dass er der artenreichste der Welt ist, was nichts Tolles war, sondern eigentlich ein Skandal. Wenn aber Zoos, und das ist erfreulicherweise immer häufiger der Fall, die Liebe der Menschen zu Tieren fördern, um auf deren Gefährdung aufmerksam zu machen, dann ist das eine gute Sache