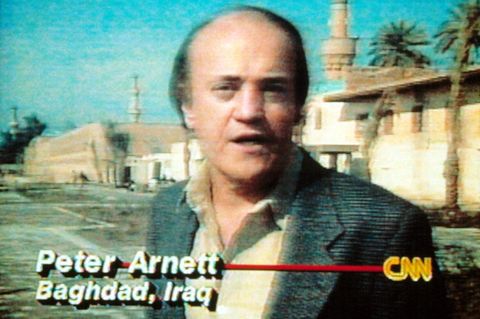Als US-Fernsehreporter John Donvan endlich im irakischen Kriegsgebiet angekommen war, erwartete er jubelnde Iraker. Zumindest hatten viele seiner Kollegen solche Bilder nach Hause gesendet, während sie als Begleiter der amerikanischen Soldaten in eroberte Städte eingezogen waren. Doch in Wirklichkeit stieß der Berichterstatter des Senders ABC auf hasserfüllte Einheimische, die den Amerikaner als "Satan" beschimpften. Diese Erfahrung zeige den Unterschied zwischen den "eingebetten Reportern“ und den anderen, sagte Donvan auf einer Podiumsdiskussion in Washington. Sein Fazit: "Ich habe einen anderen Krieg gesehen."
Donvans Berichte waren anders
"Die Leute sahen mich als einen der Invasoren", erzählt der Korrespondent. Donvan berichtete per Telefon über seine Erfahrungen - und stieß in seiner Heimatredaktion auf Unglauben. Sieben "eingebettete" ABC-Reporter schickten Erfolgsmeldungen, nur Donvans Berichte waren anders. "Es dauerte zwölf Stunden, bis meine Geschichte auf dem Sender war", sagt Donvan, "und das lag nicht nur an technischen Problemen."
Rund drei Monate nach der Heimkehr der meisten Kriegsreporter aus dem Irak ist deren Bilanz zwiespältig: Einerseits würden sich 89 Prozent der "eingebetteten" Journalisten im nächsten Krieg wieder an die Seite der US-Streitkräfte begeben, wie aus einer Umfrage der Defense Information School in Fort Meade (Maryland) hervorgeht. Andererseits häufen sich die Klagen über die Schwächen des Programms - auch von Journalisten, die selbst dabei waren.
"Keinen Überblick über die Lage im Irak"
Am häufigsten beschwerten sich die Reporter darüber, dass sie von "ihrer" Einheit an der Front nicht genug Informationen zum übrigen Kriegsverlauf erhalten hätten, sagt Oberstleutnant Richard Long, der ehemalige Koordinator des Programms beim US Marine Corps. Ein Punkt, der im Falle einer Fortsetzung des Programms in künftigen Kriegen überdacht werden müsse.
Das fordert auch William Branigin, Kriegsreporter der "Washington Post". Er begleitete sieben Wochen lang die Soldaten einer US- Kompanie durch die irakische Wüste. "Ich hatte keinen Überblick über die Lage im Irak", sagt er. "In der ganzen Zeit habe ich nie einen General getroffen." Seine Informationen zum Kriegsverlauf bekam Branigin per Satellitentelefon von der Heimatredaktion.
"Schritt in die richtige Richtung"
Auch der Vorwurf der Zensur lastet auf dem Programm. So beschwerten sich elf Prozent der mehr als 100 befragten Reporter über einen "ungünstigen" Einfluss der vom Pentagon aufgestellten Regeln zur Berichterstattung, 46,5 Prozent über einen "mäßig negativen" Einfluss. Eines seiner Hauptziele scheint das Pentagon allerdings erreicht zu haben: Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Reporter gaben an, dass die Erfahrungen im Irak ihre Wahrnehmung des US- Militärs "beeinflusst" haben. Vermutlich deswegen nennt Oberstleutnant Long das Programm vorsichtig "einen Schritt in die richtige Richtung".