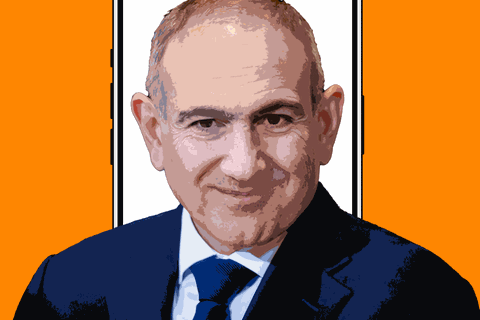Ich habe sie mir immer wieder angeschaut, natürlich, die Bilder von fröhlichen Kindern im schrecklich luxuriösen Diktatorenpalast, von den gestürzten Statuen, von den zerrissenen Bildern, die Syriens Endlich-nicht-mehr-Diktator Baschar al-Assad zeigten. Wenn Diktatoren stürzen, werden sie auf einmal ganz klein, selbst wenn ihre Familie wie die Assads fünf Jahrzehnte an der Macht war, selbst wenn ihre Schergen angeblich 72 Foltermethoden beherrschten. Dann denkt man wieder daran, dass diese absoluten Herrscher bei all ihrer Macht in ewiger Furcht leben, dass die scheinbare Ruhe in ihrem Reich ein Pulverfass sein kann.
Und doch wollte sich bei aller Freude ein Gefühl nicht einstellen: die Gewissheit, dass nun Hoffnung in der Luft liegt. Zu viele Erinnerungen drängten sich bei mir dagegen auf, etwa an die Lage in Ägypten, wo einst der Arabische Frühling so greifbar war. Die Menschen tanzten in den Straßen, der Dauer-Diktator Mubarak trat endlich ab; eine Studienfreundin aus dem Land schrieb mir: "Endlich können wir unser Ägypten gestalten." Ich war erst vor wenigen Wochen in Ägypten, es ist immer noch ein wunderschönes Land, mit so freundlichen Menschen, aber in deren Augen ist Angst zu sehen, wenn sie hochgerüsteten Soldaten und Polizisten begegnen. Von wegen Freiheit. Der Diktatorensturz war nur eine kurze Episode, heute wird Ägypten autoritärer regiert denn je. Ob die Zeiten im geschundenen Syrien wirklich bessere werden, ist noch völlig unklar.
Verrat an Syrien
Und eine zweite Erinnerung drängte sich in den Vordergrund, daran, wie früh und wie lange wir Syrien verraten haben. 2013 wollte der damalige US-Präsident Barack Obama eine rote Linie ziehen, wollte den Einsatz Assads von Giftgas gegen das eigene Volk nicht tolerieren. Aber als Assad diesen wagte, mochte Obama dann doch lieber nichts dagegen tun. So ebnete auch dies den Weg dafür, dass in den Folgejahren Wladimir Putin und Co. Assads Krieg gegen sein eigenes Land brutalstmöglich stützten, etwa mit der perfiden Taktik, erst aus einem Flugzeug eine Bombe auf Hospitäler zu werfen – und dann nach einer halben Stunde dieses Flugzeug zurückkehren zu lassen, mit einer weiteren Bombe, damit auch die zivilen Ersthelfer sterben. Die Menschen flohen, so viele, dass es Gesellschaften in Europa an ihre Grenzen brachte, auch in Deutschland.
Wir, die westliche Welt, haben uns damals nicht getraut, Assad am Morden zu hindern, und auch in den vergangenen Jahren haben wir die Lage in Syrien meist lieber vergessen. Gestürzt ist Assad keineswegs, weil wir so entschieden gegen ihn aufgetreten wären. Sondern weil jene Schurken, die den Schurken so lange stützten, abgelenkt sind, der Iran und die Hisbollah vom Kampf mit Israel, die Russen von ihrem Angriffskrieg in der Ukraine. Aus dem Sturz von Assad abzuleiten, dass die Demokratie stärker sei als die Autokratie – dafür ist es viel zu früh. Denkbar wäre aber eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik, auch in Deutschland. Damit meine ich nicht plumpe Forderungen, die bestimmt kommen werden: Entweder das Schüren von Ängsten, dass nun viele neue Flüchtlinge zu uns kommen könnten. Oder die Forderung, alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland, fast eine Million, müssten nun schleunigst zurück in ihre Heimat.
Assads Sturz könnte Flüchtlingskrise entspannen
Und doch: Besonnene Stimmen wie der renommierte Migrationsforscher Gerald Knaus sehen nach dem Sturz des Assad-Regimes die Chance auf Entspannung in der Flüchtlingskrise. "Mittelfristig – sollte Stabilität hergestellt werden – könnte das für die gesamte Flüchtlingssituation, auch in Europa, ein historischer Wendepunkt sein", sagt Knaus dem stern. "Syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern haben sofort die Chance zu sehen, ob es in ihrer Heimat wieder sicher ist. Ist das so, werden auch Asylanträge in Deutschland und anderen europäischen Ländern zurückgehen."
Das könnte unsere Flüchtlingsdebatte, die den anstehenden Wahlkampf zu vergiften droht, entschärfen. Deswegen müsse die Stabilisierung Syriens absoluten Vorrang haben, sagt Knaus. In Form einer Kontaktgruppe etwa: "Jordanien müsste dabei sein, die Türkei, Österreich, Griechenland, Deutschland, die EU und die nächste syrische Regierung. Diese Gruppe muss eine Strategie entwerfen, und die EU muss sie unterstützen." Deutschland sollte vorangehen, auch aus Eigeninteresse, immerhin haben in den vergangenen zwei Jahren 80 Prozent der Syrer in der Europäischen Union Schutz in Deutschland gesucht (sowie in Österreich). Über dieses Thema sollten die deutschen Wahlkämpfer bald sprechen, ruhig auch streiten. Gut wäre nur, wenn dabei klar bliebe: Wir reden nicht über Zahlen, sondern Menschen.