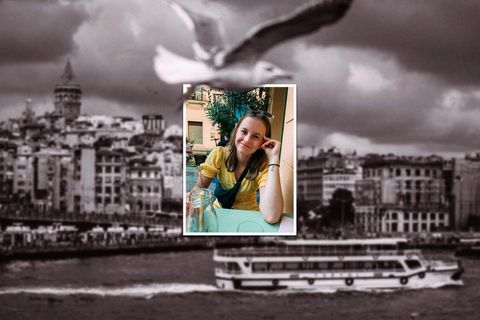Berlin, 15. März 1921. Ein grauer, nasskalter Tag mit manchmal aufblitzender Sonne. Talaat Pascha, ehemaliger Großwesir des Osmanischen Reichs, eilt durch die Hardenbergstraße, auf dem Weg zu politischen Freunden, die mit ihm den Traum vom Wiedererstarken der Türkei träumen. Plötzlich fällt ein Schuss. Am Hinterkopf getroffen, bricht Talaat zusammen. Er ist auf der Stelle tot. Ein Student, offenbar ein Landsmann, wird in der Fasanenstraße gestellt. "Wir beide Ausländer", stammelt er in gebrochenem Deutsch bei seiner Verhaftung. "Ganz allein unsere Sache."
Eine Szene scheinbar wie aus unseren Tagen. Konflikte, die sich in der Türkei aufgestaut haben, entladen sich hier bei uns, mitten in Berlin. Doch was für ein Attentat war das an jenem grauen Tag? Der Anschlag eines kurdischen Separatisten? Nein - fast möchte man sagen: das Gegenteil. Das Attentat wurde von einem Armenier verübt, einem "Avenger", als Rache für ein Blutbad, das Talaat zur Zeit des Ersten Weltkriegs organisiert hatte und für das er in Abwesenheit in der Türkei verurteilt worden war: die Deportation großer armenischer Bevölkerungsteile, bei der Hunderttausende von Menschen den Tod fanden - gemeinsam ausgeführt von Türken und Kurden, unter stillschweigender Duldung ihrer deutschen Waffenbrüder.
Zur Person
Peter Prange, 52, ist promovierter Philosoph und Autor. 2006 veröffentlichte er das Sachbuch "Werte. Von Plato bis Pop. Alles, was uns verbindet". In seinem jüngsten Roman "Der letzte Harem" (Droemer und Knaur) setzt er sich intensiv mit der Geschichte der Türken auseinander. Mehr über den Autoren unter: www.peterprange.de
Beim Schreiben meines Harem-Romans habe ich eines begriffen: Wenn es um das Thema Multikulti geht, sind die Türken uns um Jahrhunderte voraus. Im Guten wie im Schlechten. Schon der Harem des Sultans war eine Multikulti-Gesellschaft en miniature. Die Frauen des Herrschers stammten buchstäblich aus aller Herren Länder, genauso wie die Sklavinnen und Eunuchen. Nur wenige Mitglieder des Harems waren türkisch, selbst in den Adern der Sultane floss kaum türkisches Blut - ihre Mütter stammten ja allergrößten Teils aus Europa. Im Harem galt darum der egalitäre Grundsatz, dass es weder Armenierinnen noch Kurdinnen gab, sondern nur Ehefrauen, Konkubinen und Dienerinnen. Ihr Rang bemaß sich nicht nach ihrer ethnischen Herkunft, sondern nach Schönheit und Bildung - sprich: nach persönlichen Vorzügen.
Dutzende von Völkern und Sprachen in einem Reich
Dieses Nebeneinander der Kulturen war symptomatisch für das ganze Omanische Reich. Dutzende von Völkern und Sprachen sowie alle großen Religionen waren in seinen Grenzen vereint. Nicht alle Bevölkerungsgruppen besaßen darin die gleichen Rechte, doch jede konnte sich einigermaßen frei entfalten, ihren Geschäften nachgehen sowie ihre Bräuche und ihren Glauben ausüben. Seit dem Römischen Reich hat es keine größere funktionierende Multikulti-Gesellschaft gegeben als diese - weltweit! Selbst der berühmte melting pot Amerika ist im Vergleich zu diesem Ozean der Kulturen kaum mehr als ein Tümpel.
Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs bekam diese Tradition jedoch einen Riss. Im Zeichen riesiger Gebiets- und Herrschaftsverluste hieß es plötzlich: "die Türkei den Türken!". An die Stelle relativer multikultureller Toleranz trat ein Nationalismus, der sich den Nationalismus europäischer Staaten des 19. Jahrhunderts zum Vorbild nahm. Das Türkische, im Osmanischen Reich keineswegs ein Adelsprädikat, wurde in der Geburtsstunde der modernen Türkei neu entdeckt, um damit die Identität der ganzen jungen Nation zu begründen.
Früher waren die Todfeinde engste Verbündete
Welche Ironie der Geschichte! Wenn wir heute an Multikulti denken, haben wir Deutsche vor allem türkische Immigranten vor Augen. Denen schallt nun aus den dunkelsten Nischen unserer Gesellschaft in abgewandelter Form ("Deutschland den Deutschen!") dieselbe Parole entgegen, mit denen die Jungtürken vor hundert Jahren die Reste des zerfallenen Osmanischen Reichs einen wollten. Und welche Ironie der Geschichte, dass damals die "Todfeinde" von heute, Türken und Kurden, sich verbündeten, um gemeinsam gegen die armenische Bevölkerung zu Felde zu ziehen. Und welche Ironie der Geschichte schließlich, dass diese Absurdität auf keinen anderen zurück geht als auf den letzten autokratischen Sultan, Abdülhamid II., auch der "rote" Sultan genannt. Als Sohn einer Armenierin selber ein halber Armenier, sah er in seinen Blutsverwandten den "inneren Feind", der verantwortlich war für den Niedergang seines Reiches und den es darum mit Hilfe kurdischer Verbündeter beziehungsweise Kapos "auszumerzen" galt.
Diese Kapo-Tradition, eine Ethnie, die die eigene Dominanz in Frage stellt, gegen eine andere, ähnlich gefährliche auszuspielen, diese Tradition, die mit den Pogromen unter Abdülhamid 1894/95 begann, setzte sich mit den Pogromen der Jungtürken 1915/16 fort. Mit dem geradezu logischen Resultat, dass die Dominanz des Türkentums, das zu verunglimpfen nach wie vor einen schweren Straftatbestand erfüllt, auch die kurdische Bevölkerung ins Visier nahm, wo immer diese nach eigener Identität strebte. Weshalb deren radikalen Vertreter wiederum sich nun legitimiert fühlen, ihre Ansprüche mit allen Mitteln durchzusetzen - und wenn es das Leben unschuldiger Menschen kostet.
"Ich würde mir wünschen", sagte eine Lehrerin der deutschen Schule in Istanbul nach dem Attentat auf den armenischen Journalisten Hrant Dink vor ihrer Klasse und trug sich damit eine Menge Ärger ein, "ich würde mir wünschen, dass die Türkei beginnt, sich mit ihrer Geschichte auseinander zu setzen." Niemand kann für die Taten oder Untaten seiner Väter zur Verantwortung gezogen werden. Dieser Grundsatz, auf den wir jüngeren Deutsche uns gerne berufen ("Gnade der späten Geburt"), gilt auch für jeden Türken. Doch auch wenn jeder nur für das Verantwortung trägt, was er selbst getan hat, ist er doch verantwortlich für die Art und Weise, wie er mit dem Erbe umgeht, das seine Väter ihm hinterlassen.
Können wir aus der Geschichte lernen?
Damit stellt sich eine alte Frage aufs Neue: Können wir aus der Geschichte lernen? Ich meine, eines zeigt die Geschichte immerhin. Je schwächer eine Gesellschaft sich in ihrem Innern fühlt, umso schwerer fällt es ihr, Fremdes zu ertragen. Statt als mögliche Bereicherung wird dieses als Bedrohung und Infragestellung der eigenen Identität begriffen. Fremdenhass zum Zweck der Selbstaufwertung ist die Folge. Die Akzeptanz des Fremden hingegen scheint Ausdruck von Stärke zu sein. Eine selbstbewusste Gesellschaft kann andere Werte außer ihren eigenen akzeptieren und sogar von ihnen profitieren - eine Gesellschaft, die ihrer selbst ungewiss ist, kann das offenbar nicht. Zu schwach für Toleranz und Respekt vor dem anderen, "stärkt" sie ihr Ego durch Ausgrenzung, Unterdrückung und Verfolgung.
Das zeigt nicht nur die türkische, sondern auch und gerade die deutsche Geschichte. Wenn es um die Ausgrenzung, Unterdrückung und Verfolgung des Fremden geht, müssen wir Deutsche uns zu allererst an die eigene Brust klopfen. Im Namen keines anderen Volkes wurden so schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wie in unserem. Doch haben wir immerhin den Mut gehabt, uns unserer Geschichte zu stellen. Um zu vermeiden, dass sich im Namen unseres Volkes ähnliche Verbrechen jemals wiederholen.
"Ich bin bereit", sagte Talaat Pascha nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Voraussicht seines Endes, "für das, was ich getan habe, zu sterben, und ich weiß, dass ich dafür sterben werde." Diesem lebensverachtenden Fanatismus, in den die nationalistische Perspektive früher oder später stets mit geradezu unausweichlicher Logik einzumünden scheint, können wir nur eine vielleicht altmodische, aber lebensbejahende Humanität entgegensetzen. Eine Humanität, in der Menschen einander als Menschen begegnen, statt als Vertreter einzelner Bevölkerungsgruppen, Glaubensgemeinschaften oder Parteien. Eine Humanität, in der Menschen einander nicht nach ethnischer Herkunft wertschätzen, sondern nach ihren persönlichen Qualitäten. Wie ehedem im Harem des Sultans.
In diesem Sinn würde auch ich mir wünschen, dass die Türkei beginnt, sich mit ihrer Geschichte auseinander zu setzen. Nicht zuletzt als Voraussetzung dazu, dieses Land mit seinem wunderbaren kulturellen Reichtum, den es einer wunderbaren kulturellen Vielfalt verdankt, in Europa willkommen zu heißen.