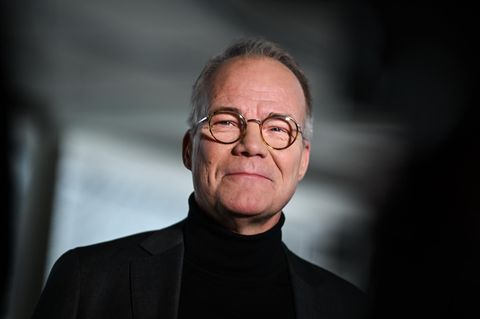Das seit Monaten diskutierte Heizungsgesetz – amtlich "Gebäudeenergiegesetz" (GEG) – ist am Freitag vom Bundestag verabschiedet worden. Für das Gesetz stimmten 397 Abgeordnete, mit Nein 275 bei 5 Enthaltungen. Nach den Plänen sollen neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.
Die neuen Regeln sollen ab Januar 2024 aber zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Bei allen anderen Gebäuden sollen die Kommunen erst eine Wärmeplanung vorlegen. In einer begleitenden Entschließung einigten sich die Ampelfraktionen zudem auf höhere Fördersätze.
Vier FDP-Abgeordnete enthielten sich – und ein Grüner
In den Monaten vor der Abstimmung gab es innerhalb der Ampel-Koalition streit um das Gesetz. Die FDP hatte sich quergestellt. Auf Druck vor allem der Liberalen gab es grundlegende Änderungen. Dennoch haben am Freitag nicht alle Abgeordneten der Ampel-Parteien Grüne, FDP und SPD für das Heizungsgesetz gestimmt, wie das Abstimmungsergebnis zeigt. Die fünf Enthaltungen bei dem Votum kommen allesamt aus den Ampel-Reihen:
- Bernhard Herrmann (Bündnis90/Die Grünen)
- Katja Adler (FDP)
- Claudia Raffelhüschen (FDP)
- Linda Teuteberg (FDP)
- Gerald Ullrich (FDP)
Vor dem Beschluss des Heizungsgesetzes gab es im Bundestag eine kontroverse und lautstarke Debatte. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte das Gesetz gegen scharfe Kritik der Opposition. Er sagte: "Ich finde es berechtigt, mit konkreten und auch besorgten Nachfragen auf dieses Gesetz einzugehen. Was man allerdings nicht durchgehen lassen sollte, ist, den Menschen Sand ins Auge zu streuen – zu sagen, wir machen Ziele, aber wir tun nichts dafür, dass diese Ziele erreicht werden."
Die unionsgeführte Bundesregierung habe beschlossen, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein solle. Es seien aber keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen worden, sagte Habeck. Nun werde es konkret, Millionen von Menschen seien betroffen. Er nehme Sorgen sehr ernst. Das Gesetz schaffe Rechtssicherheit, schütze die Verbraucherinnen und Verbraucher vor hohen Energiepreisen und sorge für eine soziale Ausbalancierung.
Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge räumte Fehler ein. Sie sagte, die Koalition habe hart miteinander gerungen, zu oft auch öffentlich – und bei den Bürgern Verunsicherung erzeugt, die nicht nötig gewesen wäre.
Über das Gesetz hatte es monatelange Konflikte auch in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP gegeben. Auf Druck vor allem der FDP hatte es grundlegende Änderungen des ursprünglichen Entwurfs gegeben. Die FDP betont vor allem "Technologieoffenheit" – nach dem Motto: "Die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt."
Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf der Plattform X (früher Twitter): "Es ist nun kein Gesetz mehr, vor dem Menschen Angst haben müssten, weil der Staat in ihren Heizungskeller steigt." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf X unter Verweis auf das Ziel der Klimaneutralität: "Ein weiterer guter Schritt."
Oppositionskritik und rechtliches Risiko
Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) nannte das Gesetz "Irrsinn" und ein "Konjunkturprogramm für Populisten". Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einem kommunikativen "Desaster". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, die vorgesehene künftige staatliche Förderung sei unzureichend. "Dieses Gesetz macht die Menschen arm."
Das Gesetz sollte eigentlich Anfang Juli und damit vor Beginn der Sommerpause beschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht aber stoppte eine Verabschiedung vor der Sommerpause. Das Gericht hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt.
Heilmann kritisierte am Freitag im Bundestag, dass es keine erneute Sitzung des zuständigen Bundestagsausschusses gegeben habe. Er hatte mit Blick auf eine weiter anhängige Klage bereits gesagt, er halte die letzte Lesung im Bundestag allein für nicht ausreichend. Sollte die Regierung nicht nachsteuern, würde sie ein formell verfassungswidriges Gesetz beschließen – es bleiben also Risiken für das Gebäudeenergiegesetz. Eine Zustimmung im Bundesrat gilt aber als sicher.
Ampel-Koalition begründet Gesetz
Die Koalition begründet die Reform im Gesetzentwurf damit, dass Deutschland ohne ein schnelles Umsteuern bei der Gebäudewärme weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren könne. Mehr als 80 Prozent der Wärmenachfrage werde aktuell noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt, dabei dominiere Erdgas.
Zudem dürfte eine auf erneuerbaren Energien basierende Wärmeversorgung mittel- bis langfristig eine sehr viel kalkulierbarere, kostengünstigere und stabilere Wärmeversorgung gewährleisten: "Insbesondere der Nutzung der überall kostenlos verfügbaren erneuerbaren Umweltwärme mittels Wärmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende Rolle zukommen."