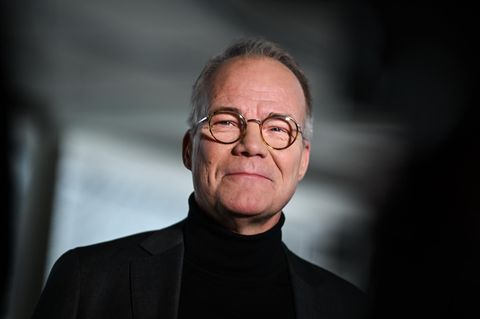1. Ich bin der Kandidat
Glückauf, Genossen, das wird schon wieder – und zwar mit mir: "Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden", hält Scholz gleich zu Beginn des Kreuzverhörs fest. Die Botschaft: Da gibt es keine Diskussion. Die SPD stehe "sehr geschlossen" und sei "sehr entschlossen", auch die Bundestagswahl 2025 zu gewinnen. Dabei wurde dem unpopulären Kanzler gerade erst in einer Umfrage bescheinigt, dass ihn nur ein Drittel der Parteimitglieder als nächsten SPD-Kanzlerkandidaten haben will. Auch die Begeisterung für die SPD selbst, der aktuell 14 bis 15 Prozent prognostiziert werden, hält sich in Grenzen.
Scholz zeigt sich davon demonstrativ unbeeindruckt, sicher auch, um eine entsprechende Dynamik gar nicht erst entstehen zu lassen. Er sei überzeugt, sagt der Kanzler, dass die Sozialdemokraten bis zur Wahl "die Sache gedreht haben". Er baut dabei offensichtlich auf den Knalleffekt der letzten Wahl: Spätestens an der Wahlurne wird dem Wähler schon einleuchten, was er an Scholz und der SPD hat.
"Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch", sagt der Kanzler dann noch, zwar mit Blick auf die politische Großlage, aber wohl auch an seine Genossen. Das ist auch eine Ansage: Schon beim letzten Mal wollte keiner an meinen Sieg glauben, aber nun sitze ich hier.
2. Scholz knöpft sich das BSW vor
Bundestagsabgeordnete hören auf, Landräte kündigen: In Teilen Ostdeutschlands scheint die Stimmung für viele Politiker gerade so unangenehm, dass sie aussteigen. Auch der Kanzler hat das registriert und nimmt die jüngsten Fälle zum Anlass, sein – zugegeben nicht sehr breites – Repertoire prägnanter Begriffe zu erweitern. Scholz sieht "Spaltungsunternehmer" am Werk. Nicht nur aus den Reihen der AfD, sondern auch aus dem Bündnis von Sahra Wagenknecht. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Spaltungsunternehmer, die Polarisierungsunternehmer, nicht den Ton in unserer Gesellschaft angeben", mahnt Scholz.
Sein Hinweis auf das BSW ist insofern bemerkenswert, als dass sich bei den Sozialdemokraten langsam der Eindruck festsetzt, die SPD leide unter dem Aufstieg des Wagenknecht-Bündnisses mit seinen Parolen von Frieden und Gerechtigkeit besonders. Einen echten Anti-Wagenknecht-Plan präsentiert der Kanzler allerdings nicht. Zusammenhalt, vernünftiges Regieren, Lösungen statt Lautsprechertum: Scholz wiederholt einfach sein altes Mantra. Ob das reicht, um die Partei der früheren Linken-Politikerin klein zu halten? Darüber werden die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September Aufschluss geben.
3. Erst Biden, dann Harris? Nur nicht Trump
Scholz würde den früheren und vielleicht künftigen US-Präsidenten Donald Trump vermutlich auch zu den "Spaltungsunternehmern" und populistischen Lautsprechern zählen. Offen sagt er das nicht, versucht nicht in die Falle zu tappen, die ihm mehrmals gestellt wird. Stattdessen betont der Kanzler, dass er mit jeder US-Regierung gut zusammenarbeiten würde – das sei ja immerhin seine Aufgabe. Schon klar. Trotzdem kann (oder will) sich Scholz den Satz nicht verkneifen: "Ich halte sehr gut für möglich, dass Kamala Harris den Wahlkampf gewinnt." Sie sei kompetent, erfahren und wisse, was sie will und kann.
Über Trump hingegen verliert Scholz praktisch kein Wort, formuliert sogar bewusst unscharf bei der Antwort auf die Frage, ob er nach dem Attentat persönlichen Kontakt zu ihm aufgenommen hat: "Ich pflege als Regierungschef den direkten Kontakt zu Regierungen."
Eine subtile Distanzierung? Möglich. Schon neulich sagte Scholz in einem Interview mit der "Welt", dass Joe Bidens Wiederwahl "sehr wahrscheinlich" sei, was für erheblichen Unmut im Trump-Lager sorgte. Nun hält Scholz Harris' Wahl – die sehr wahrscheinlich für seinen "Freund" Joe Biden als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten einspringt – für möglich.
4. Schluss mit dem Schlendrian in der Migrationspolitik
Auch Scholz hat das Urteil mit Interesse verfolgt: Ein Gericht in Münster zweifelt am pauschalen Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. "Das unterstützt die Haltung der Bundesregierung und des Bundeskanzlers", betont Scholz in der Pressekonferenz. Schleuser, wie in diesem Fall, könnten keinen Schutz in Deutschland genießen – und dürften auch nach Syrien abgeschoben werden.
Der Kanzler inszeniert sich als Anpacker, der die Asyl- und Migrationspolitik zur Chefsache gemacht hat. Muss er auch, Scholz hat Erwartungen geweckt.
Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Mannheim hatte er angekündigt, Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder auch wieder nach Afghanistan und Syrien abzuschieben – kein leichtes Unterfangen, zumal rechtlich. Auch Scholz spricht von "nicht ganz unkomplizierten" Vorgängen, versichert jedoch, "dass Sie (die Journalisten) bald auch zum Beispiel berichten können über Abschiebungen, die nach Afghanistan konkret auch durchgeführt worden sind." Die Botschaft: Das passiert, und zwar sehr bald.
Grundsätzlich will Scholz den Eindruck erwecken, dass die Ampel das Reiz- und Streitthema der irregulären Migration anpackt. "Nicht nur meckern, sondern handeln", lautet Scholz' Devise, und "dem Schlendrian einen Schluss" machen: Es soll mehr Abschiebungen geben.
5. Die Abschreckungs-Doktrin
Sehr geschlossen sei die SPD, betont der Kanzler mehrfach. Allerdings schreckte eine Entscheidung die Sozialdemokraten unlängst auf: Die Ansage von Scholz, dass die USA ab 2026 wieder Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren würden, die weit bis nach Russland reichen.
Der Friedensflügel der Partei, der an Zulauf gewinnt, je länger der Krieg in der Ukraine dauert, war darüber wenig begeistert, sieht in der Entscheidung das Risiko einer schleichenden Eskalation mit Russland. Scholz bleibt hart, verteidigt die Absprache mit Washington. Die Entscheidung diene der Abschreckung, sie sorge dafür, dass Deutschland nicht angegriffen werde und kein Krieg stattfinde.
Übrigens sei es Russland gewesen, das sich über die Rüstungskontrollvereinbarungen der vergangenen Jahrzehnte hinweggesetzt habe, sagt Scholz. Dann macht er, was er selten macht: Er erzählt aus einem vertraulichen Gespräch mit Wladimir Putin. Dem russischen Präsidenten habe er kurz vor dem Krieg im Februar 2022 angeboten, über Rüstungskontrolle zu reden und über die konkrete Stationierung von Raketen. Putin sei daran nicht interessiert gewesen, sondern längst dabei gewesen, seinen Krieg vorzubereiten. Die Botschaft des Kanzlers: Nicht wir sind hier die Bösen – der Herr im Kreml ist es.