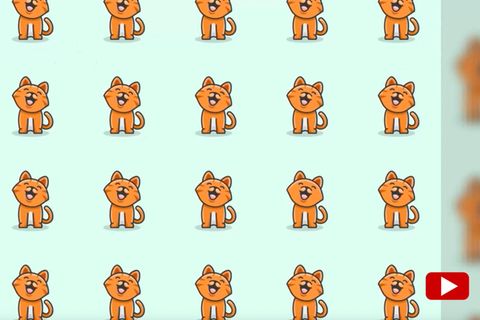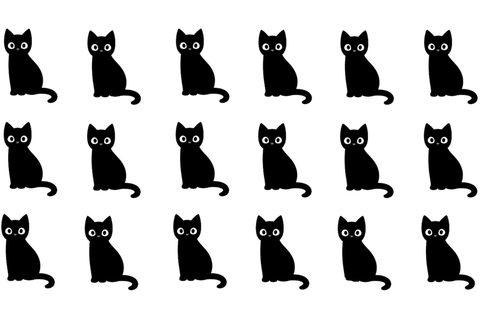Es ist hohe Zeit, über Gier zu reden. Über ethische Entwurzelung und politische Verantwortungslosigkeit - über aberwitzige Millionen-Bezüge deutscher Spitzenmanager in Zeiten des Verzichts von Millionen. Denn die Selbstbedienung bei Gehältern, Prämien, Aktienoptionen und Pensionszusagen wirft längst nicht mehr nur die Frage nach dem Wertegerüst der Wirtschaftselite auf, nach dem Verhaltenskodex, den sie selbst Corporate Governance nennt. Sie wird zur Bedrohung für jede Reformpolitik, untergräbt, diskreditiert, ja sabotiert die Akzeptanz jener sozialen Schnitte, nach denen die Wirtschaft selbst ruft. Die Millionen der Manager sind keineswegs Privatsache, achselzuckend beschwiegene Zwangsläufigkeit rasender Globalisierung, sie sind Politikum.
Der Kapitalismus lässt den Sozialismus wieder auferstehen
Die größte Bedrohung nach dem Zerfall des Sozialismus sei der Kapitalismus, sagt der Investment-Milliardär George Soros. Der Kapitalismus hat den Sozialismus besiegt - nun ist er selbst dabei, ihn wieder auferstehen zu lassen, weil er Vertrauen und Glaubwürdigkeit zermalmt. Der Triumph der Linken in Frankreich über die bürgerliche Reformpolitik war ein erstes Symptom; die gewerkschaftlichen Massenproteste und die symbolische Rötung der SPD sind die Folgen hierzulande.
Bolko von Oetinger, Spitzenmann der Unternehmensberatung Boston Consulting, mahnt den Kapitalismus zur "Wiedereinbindung in die Gesellschaft". Denn die Kaste der Manager löst sich aus ihr. Die Debatte über die Vaterlandslosigkeit des Kapitals, das deutsche Subventionen einstreicht und Jobs wie Vermögen in Lohn- oder Steuerparadiese verschiebt, ist nur eine milde Eruption schlummernder Wut - Vorbote dessen, was noch kommt. Kommen muss. Für die deutschen Aktiengesellschaften beginnt die Saison der Hauptversammlungen. Das Salär der Vorstände wird vielfach attackiert werden - von Aktionären, die sich ausgeplündert fühlen. Das ist nichts gegen die lodernde Empörung der Besitzlosen.
Die Luxus-Komödie "Happy days, fat cats"
Denn vor den Augen des Volkes laufen zwei Filme ab, die sich gegenseitig dementieren. Im Kino der Politik spielt der Reform-Krimi "Sad times, poor dogs": Rentenkürzung, Praxisgebühr, Lohnstillstand, Arbeitszeitverlängerung, Lockerung von Kündigungsschutz und Tarifverträgen. Im Lichtspielhaus der Wirtschaft flimmert die Luxus-Komödie "Happy days, fat cats": beste Bilanz der Dax-Konzerne seit 1996, 30 Prozent mehr Gewinn; sattes Plus bei den Vorstandsbezügen - 108 Prozent bei Eon, 57,5 Prozent bei Thyssen-Krupp, 45,6 Prozent bei der Allianz. Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, kassierte vergangenes Jahr 11,1 Millionen Euro - fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Klaus Esser, Ex-Mannesmann-Lenker, brüstete sich vor Gericht, 30 Millionen Euro Handgeld beim Verkauf des Konzerns seien für ihn eigentlich zu wenig gewesen. Nun wird er wohl auch noch freigesprochen.
"Hier fehlt es an ethischem Bewusstsein", urteilt Horst Köhler, Bundespräsident in spe. Solches Fehlverhalten könne "das Unternehmertum insgesamt in Misskredit bringen". Nicht nur das Unternehmertum, auch die Politik. Denn wie sollen die Parteien - gleichgültig, ob SPD oder CDU - Vertrauen und Mehrheiten für zwingende Sozialreformen mobilisieren, wenn das Volk den Eindruck haben muss, in Wahrheit werde nur Geld von unten nach oben geschaufelt? Wie soll speziell die CDU das ohnehin gewagte, aber überaus sinnvolle Kopfprämien-Konzept für die Krankenversicherung populär machen, wenn doch der Millionen scheffelnde Chef den gleichen Beitrag zahlt wie sein kurz gehaltener Chauffeur? Nicht die Projekte der Politik sind unsozial, die "fetten Katzen" tauchen sie ins Zwielicht sozialer Ungerechtigkeit.
Die Manager sollten zehn Prozent ihres Salärs an die Unis abtreten
Was also tun? Wer Reformen will, muss auch persönlich für sie einstehen - und das Klima dafür schaffen. Zumutungen für ein ganzes Volkes lassen sich nur legitimieren, wenn die Eliten Vorbild sind, die Politik vom Verdacht befreien, sie diene privater Bereicherung. Zeit also für einen patriotischen Pakt der Manager mit der Politik, organisiert von den Spitzenverbänden der Wirtschaft: Bis 2008, zwei Jahre nach der nächsten Wahl, verzichten Deutschlands Manager freiwillig auf zehn Prozent ihres Einkommens - und speisen damit einen Fonds zur Finanzierung von Spitzenleistungen der Universitäten. 250 Millionen Euro will der Bund dafür mobilisieren; die Wirtschaft könnte 100 Millionen drauflegen. Für Josef Ackermann hieße das eine Einkommenskürzung auf jährlich zehn Millionen. Der Mann würde nicht verarmen.