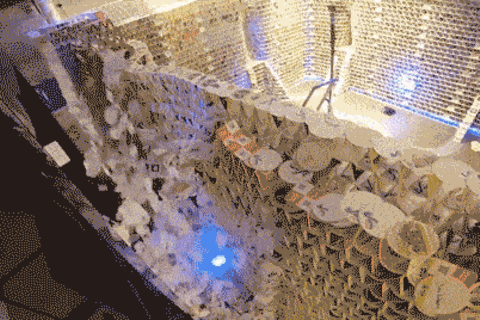Von der Nordsee bis zur Adria | |
Historische Situation | |
| Vom Ansturm germanischer Völker zermürbt, bricht das Weströmische Reich gegen Ende des 4. Jahrhunderts zusammen. Es bilden sich germanische Kleinstaaten. Die Franken unter den Merowingern und später den Karolingern unterwerfen die germanischen Völker zwischen Rhein und Elbe, aber auch das römische Gallien. | |
Bevölkerung | |
| Zu Beginn des 6. Jahrhunderts leben auf dem Gebiet des späteren Deutschland 650 000 Menschen - gerade mal 2 pro Quadratkilometer (heute sind es 230). | |
Lebenserwartung | |
| Geburten sind riskant, Frauen sterben oft zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr. Von den überlebenden Neugeborenen stirbt jedes zweite, bevor es fünf ist. Männer werden 50 bis 60 Jahre alt. | |
Lebensverhältnisse | |
| Wälder bedecken fast 80 Prozent des Siedlungsgebiets. Die Menschen leben in vereinzelten Höfen oder kleinen Dörfern. Typisch ist das rechteckige, hölzerne Pfostenhaus mit Giebeldach. Ackerland ist zunächst noch Gemeinschaftsgut. | |
Städte | |
| Köln, Xanten, Neuss, Trier, Straßburg sind die größeren Städte links des Rheins. Nach dem Kollaps des Weströmischen Reiches verlieren sie ihre urbane Qualität und einen Großteil ihrer Einwohner. | |
Regierungsform | |
| Die Thingversammlung spricht Recht und wählt für Kriegszüge aus dem Adel einen Heereskönig. Im 5. Jahrhundert entwickeln sich daraus Königtümer. Karl der Große regiert mit von ihm eingesetzten Grafen. | |
Bauwerke | |
| Die Germanen bauen fast nur mit Holz. Erst ab dem 7. Jahrhundert setzt sich die Steinbauweise des Mittelmeerraums - vor allem für Kirchen, Königspfalzen und Klöster - durch. | |
Sprache | |
| Während der Völkerwanderung bilden sich althochdeutsche Dialekte heraus - Bayrisch, Alemannisch, Fränkisch. Die wenigen schriftlichen Aufzeichnungen sind Mönchen zu verdanken. | |
Kulturelle Meilensteine | |
| In der "Karolingischen Renaissance" beruft man sich auf antike Vorbilder. Die Geistlichen werden im 8. Jahrhundert zu Trägern von Wissenschaft, Lehre und Schrift. Die Arbeit von Gelehrten wie Alkuin, die Einführung des Lateinischen als Schriftsprache und die Kenntnis antiker Texte legen die Basis für die Kultur des Abendlandes. | |
Ethnische Besonderheiten | |
| "Die Germanen" als einheitliche Gruppe oder gar als "erste Deutsche" hat es nie gegeben. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschland lebte im ersten Jahrtausend der Zeitrechnung ein vielfältiges Völkergemisch, das römische Geschichtsschreiber Germanen nannten: zum Beispiel Cherusker, Bataver, Ubier, Chatten, Friesen. | |
Technische Errungenschaften | |
| Erst im Laufe der Jahrhunderte setzt sich der Wendepflug durch, der die Erde - im Gegensatz zum primitiven Hakenpflug ohne Pflugschar - nicht nur aufreißt, sondern mit einem sogenannten Streichbrett auch wendet. | |
Waffen | |
| Die Germanen sind gefürchtete Nahkämpfer, die ihren Feinden - das zeigen Skelettfunde - schwere Verletzungen und Verstümmelungen zufügen: mit der bis zu 700 Gramm schweren fränkischen Wurfaxt Franziska etwa, dem fast ein Meter langen, zweischneidigen Schwert Spatha oder den Lanzen mit widerhakenbesetzten Spitzen. Zu ihrem Schutz tragen die Germanen Schilde, Helme und Brustpanzer. Das 25 Zentimeter lange, einschneidige Kurzschwert Sax haben sie stets griffbereit am Gürtel. | |
Landwirtschaft und Ernährung | |
| Angebaut werden vor allem Gerste und Roggen, dazu Dinkel, Hirse und Hafer, Erbsen, Saubohnen, Linsen, Kohl, Mohrrüben, Sellerie. Wenn die Felder keinen Ertrag mehr bringen, erschließt man mit Brandrodung neue Anbauflächen. Das Vieh (Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen) lässt man im Wald grasen. Auf dem Speisezettel stehen Getreide- oder Bohnenbrei, Eintopf aus Gemüse und Fleisch, Käse, Wildfrüchte, manchmal Fisch. | |
Handel | |
| Schon seit dem Altertum treiben die Germanen Handel mit dem Mittelmeerraum. Vor allem der Sklavenhandel setzt sich über die Jahrhunderte unvermindert fort. Aber auch an römischen Luxusgütern wie Silber, Gläser, Schmuck und Metallgeschirr finden die Germanen Gefallen. Während im Landesinnern noch der traditionelle Tauschhandel dominiert, handelt man in den grenznahen Gebieten schon wie die Römer mit Münzen. Die Römer importieren Getreide, Pelze, Bernstein, Federn, Seife und - als Modeartikel in Rom eine Sensation - blondes Frauenhaar. | |
Zeugnisse der Epoche | |
| Moorleichen aus dem 1.-2. Jahrhundert, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig. | |
| Die Torhalle von 772 | im Kloster Lorsch bei Darmstadt. |
| Pfalzkapelle im Aachener Dom | |
| Hildesheimer Silberfund in der Antikensammlung der | Staatlichen Museen, Berlin |
| Limesmuseum in Aalen, |