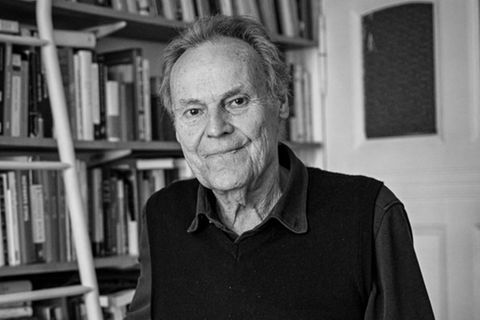Und dann fletscht er doch wieder die Zähne. Die Spree glitzert sich durch die Brücken hindurch, Japaner, nur wenige mit Mundschutz, eilen Richtung Unter den Linden, ein paar Brit-Chicks kichernd am U-Bahn-Schacht, gediegene Businessmen, die Aktenkoffer spazieren führen, und an der Kreuzung bremst ein Auto, Fenster runter, und der Fahrer brüllt: "Noch mal den Finger, Freundchen, und du kriechst 'n paar uffs Maul."
So ist er nun mal, dieser Köter namens Berlin. Wedelt mit dem Schwanz, wenn man ihn streichelt und füttert, doch wenn man ihn gerade zu lieben beginnt, schnappt er zu. Räudige Töle. Raue Stadt, grau und grün, nicht romantisch wie Venedig, nicht so zuckrig wie Paris, nicht so gigantisch wie New York, so alt wie Rom oder so gut gelaunt wie Barcelona. Kein Wunder bei dem Wetter.
Jeden Tag ganz Lissabon zu Besuch
Und doch besitzt dieser amorphe Klotz die Kraft eines globalen Magneten. Sitz einer Regierung, die von Tel Aviv bis Hollywood als Verfechterin humanistischer Werte gefeiert wird. Vollgeräumt mit Geschichte, aufgepumpt mit Coolness und gesegnet mit einem Energiefeld, das noch immer wie ein Versprechen um den Erdball strahlt: Stadt der Freiheit. Stadt der Kreativen. Start-up-City. Partyhauptstadt, das auch. Und in diesen Tagen, kurz vor der Bundestagswahl, schaut die Welt noch einmal genauer auf Berlin. Auf die Signale, die von dieser Stadt ausgehen, für die künftige Rolle Deutschlands, für die Zukunft Europas. Hauptstadt der Hoffnung.
Mögen die Nörgler sie als "Failed Stadt" beschimpfen, die weder Flughafen kann noch Verwaltung – die Völker der Welt pilgern nach Berlin, als wäre es ihr Mittelpunkt, ihr neues Babylon. Man muss nur runter in die U6 von Mitte nach Kreuzberg, wo es nicht bloß am Samstagabend zugeht wie im R-Train von Manhattan nach Brooklyn. Wo man neben Englisch, Deutsch und Türkisch viel Spanisch und Italienisch spricht, Hebräisch oder Kantonesisch.

Es sind längst nicht nur die Touristen, von denen an jedem einzelnen Tag 500.000 die Stadt bevölkern – eine halbe Million, als wäre komplett Nürnberg auf Reisen gegangen oder treffender: Ganz Lissabon, denn inzwischen kommt fast die Hälfte aller Besucher aus dem Ausland. Manche kehren wieder, für länger oder für immer. 676.000 leben heute in Berlin, die 475.000 Deutschen mit Migrationshintergrund nicht mitgerechnet. Etwa 450.000 dieser Ausländer stammen aus Europa. 135.000 Asiaten, 37.000 Nord- und Südamerikaner, 29.000 Afrikaner und 3500 Australier. Man kann inzwischen hören, beim Schrippenkauf oder am Bahnsteig, wie sich dieses 3,7-Millionen-Metropölchen zur wahrhaft internationalen Metropole mausert.
David Linderman etwa gehört zu den vielen Amerikanern, die im Bezirk Mitte wohnen. Linderman ist Creative Director, natürlich aus New York City, worauf er im Moment jedoch nicht gut zu sprechen ist. In gewisser Weise befindet sich der 47-Jährige im Exil. "Während des Wahlkampfs mit Donald Trump wurde mir klar: Ich muss weg aus den USA." Den Rest übernahm der Magnet.
Kein Berliner kann heute mehr seiner Stadt entkommen, nicht mal im Urlaub. Nicht mal in Israel. Ein heißer Abend mit neuen Freunden in einer Kleinstadt bei Tel Aviv. Hummus und Pita, und schon wieder dreht sich das Gespräch um die deutsche Hauptstadt. "Jeder Israeli war schon da. Und die restlichen fahren nächste Woche", sagen die Freunde. Die Freiheit, die Toleranz, die Preise. Jeder könne sein, was er sei, oder werden, wonach er sich sehne, und politisch sei doch Berlin inzwischen der letzte Ort, an dem die Vernunft regiere. Und Sicherheit herrsche. Und Stabilität. Die Worte klingen, als beschrieben sie das Elysion. Einwände: zwecklos.
Bald hat Berlin mehr Gäste als Paris
"Berlin ist nicht das New Kid on the Block, aber der Spätzünder unter Europas Großstädten", sagt Professorin Ilse Helbrecht, Metropolenforscherin an der Berliner Humboldt-Universität. Entgegen der Ansicht ihrer Bewohner rangierte hier lange Zeit jenseits von Selbstbewusstsein und Größenwahn wenig auf Weltniveau. Tatsächlich war diese Stadt nach der "Hochzeit von Not und Elend", wie Helbrecht das Ende der Teilung nennt, nicht viel mehr als ein Versprechen – auf billiges Wohnen und durchtanzte Nächte, bis dereinst am Morgenhimmel die goldene Zukunft leuchten möge. Vor ihrer Ankunft galt das Motto: arbeitslos und Spaß dabei. Beziehungsweise "arm, aber sexy", wie das Stadtmaskottchen Klaus Wowereit noch in den Nullerjahren den Dörfern des Globus mitteilte.
Erst jetzt, ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall, nachdem alle Hymnen und Abgesänge verklungen sind, lässt sich verkünden: Es entwickelt sich, Genossen Bauern. Nicht mehr nur spür-, sondern auch messbar, substanziell. Noch immer lebt etwa jeder sechste Berliner von Hartz IV, doch die Wirtschaft wächst so schnell wie sonst fast nirgends im Land. Die Kaufkraft steigt, die Grundstückspreise explodieren, 345 Prozent in fünf Jahren, im Mai ist die Arbeitslosenquote erstmals unter neun Prozent gefallen. Und der Tourismus feiert Jahr für Jahr neue Rekorde.
Seit 1996 hat sich die Zahl der jährlichen Gäste auf fast 13 Millionen vervierfacht. Die Hotellerie meldet 31 Millionen Übernachtungen, noch mal so viele bei Freunden plus weitere fast fünf Millionen, vermittelt über Portale wie Airbnb. Kurzum: Platz drei in der Liste der Topdestinationen Europas – hinter London und Paris. Langfristig, erwarten die Experten, wird die City of Cool die Stadt der Liebe von Platz zwei verdrängen. So manchem Berliner bereitet diese Aussicht schon kurzfristig Kopfschmerzen.

Es ist, so sagt ein Mann, der sich viele Gedanken um diese Stadt machen muss, weil er will, dass die Welt ihr weiterhin verfällt, es ist, als befände sich Berlin in einem Wildwasserkanal. Die Stadt muss aufpassen, dass sie nicht mit Wucht gegen einen Felsen knallt, aber es bleibt nichts, als sich mutig in die Strudel hineinzuwerfen. "Wir haben die Chance, es besser als andere Städte zu machen", sagt Burkhard Kieker, "die sollten wir nutzen."
Kieker leitet das Headquarter der Berlin-Vermarktung, genannt: Visit Berlin. Er eröffnet Pop-up-Stores in europäischen Städten, die gefilzte Bären aus Prenzlauer Berg feilbieten, er begleitet Daniel Barenboim, den Dirigenten und besten Berlin-Botschafter überhaupt, nach Paris, er diskutiert mit Vermarktern anderer Metropolen, wie man die Attraktivität für Bewohner und Zukunft erhalten kann. "Alle machen sich die gleichen Gedanken", sagt Kieker. "Es geht schief, wenn die Bevölkerung das, was Besucher in der Stadt sehen, selbst nicht mehr erkennen kann." In Barcelona kippen inzwischen täglich diverse Kreuzfahrtschiffe ihre Gäste über die Ramblas, Zehntausende Touristen, die sich nach ausgiebigem Bordfrühstück höchstens einen Kühlschrankmagneten gönnen. "Das wollen wir nicht", sagt Kieker, "knausrige, grölende Horden sind nicht die Zukunft Berlins. Dafür ist die Stadt zu klug."

Hipster in der Parallelgesellschaft
Längst gehört aber zur Gegenwart, dass sich Nacht für Nacht Tausende Partywütige über die Warschauer Brücke schubsen. Es kotzen auch Tag für Tag Junggesellenabschiede von Bierbikes in Richtung Hackescher Markt, rotzen Hostels den Wahnsinn vors Schlesische Tor – für die Berliner erscheinen die marodierenden Horden mancherorts als Übermacht. Dabei stellen sie tatsächlich weniger als ein Fünftel der Besucher. Die meisten kommen, um die unzähligen Stätten der Geschichte zu besichtigen, die Orte der politischen Macht, der Hoch- und Subkultur – das freie und entspannte Leben. Doch auch wenn es in Berlin mehr Museen als Regentage gibt –, ganze 180 – die Billig-Brüller sind lauter.
Bis 2018 will die Stadt nun endlich ein neues Tourismuskonzept erarbeiten – weg von der Tonnenideologie, hin zu nachhaltigem Wachstum, "stadtverträglich". Visit Berlin verteilt schon mal Flyer und Broschüren, in denen es heißt: "In Berlin, everything is allowed, if it's not verboten."
Für sich genommen klingt dieser Satz fast nach einem Fall für Jens Spahn. Die konservative Nachwuchshoffnung der CDU brachte es jüngst fertig, die politischen Feuilletons der Republik mit seinem Lamento zu beschäftigen, dass es in manchen In-Cafés nicht mehr möglich sei, den Kaffee auf Deutsch zu bestellen. Alle verfielen szenehalber lieber in "broken English", Muttersprache hin oder her. Ihm gehe das "auf den Zwirn".

Und so feuerte Spahn gleich mit großem Kaliber auf die sich global gerierenden "digitalen Nomaden", die in besagten Cafés den meisten Platz für ihre Laptops brauchen. Er, gebürtiger Ahauser, aber mit hipper Brille versehen, sprach von einer "neuen Form von Parallelgesellschaft". Auch jetzt, zwei Wochen nach dem Rundumschlag gegen die Hauptstadt-Hipster und deren Getue, sagt er spitzzüngig: "Diejenigen, die sich für kosmopolitisch halten, sind in Wahrheit sehr eintönig."
In der Gegend links und rechts der Torstraße in Berlin-Mitte, in manchen Ecken von Friedrichshain oder Neukölln hat sich der Hipster wahrlich ein Biotop eingerichtet und agiert dort mit ausgeprägtem Revierverhalten. Nur – und das scheint Spahn nicht ganz zu verstehen – ist der Hipster dort weniger Ärgernis als Attraktion. Personifizierte digital future. Er adelt Restaurants und Bars. Verwandelt den grauesten Bürgersteig in globale Trottoirs.
Man bekommt die Besten nicht nach Herzogenaurach
Es ist vielmehr so: Der Hype nährt den Hype. Im Bugwasser der bärtigen Extravaganz laufen unzählige Kreative ein – jung, gebildet, ideenreich. Weil es sich hier im internationalen Vergleich noch immer preiswert leben lässt. Und weil sie hier jene drei Ts finden, die eine Stadt laut dem renommierten US-Politologen Richard Florida braucht, um kreatives Potenzial zu locken: talent, technology, tolerance. Seit fast einem Jahrzehnt erlebt Berlin einen Ansturm dieser digitalen Boheme.
Am vergangenen Freitag hat der Co-Working-Anbieter Mindspace ein neues Gebäude mit 700 Arbeitsplätzen eingeweiht, Krausenstraße, feinste Mitte-Lage. Es ist die zweite Niederlassung in der deutschen Hauptstadt, seit das israelische Unternehmen im April 2016 an die Spree zog, im Januar wird die dritte eröffnet.
An der Bar lehnen schöne Menschen und trinken Prosecco, jeder kann sich bedienen bei Croissants und Espresso. Besucher werden auf Englisch empfangen, man zeigt sich "very international" und "very easy". Berlin vibriere, sagt der Deutschland-Chef von Mindspace, Bastian Bauer, selbst mit Bart und very easy. Was hier abgehe, sei einzigartig. Auch wenn die großen Unternehmen in München, Stuttgart oder Frankfurt säßen – "wer will denn da hinziehen? Man bekommt die Besten nicht nach Herzogenaurach. Die wollen alle nach Berlin."

Tatsächlich bieten die Co-Working-Unternehmen ein Konzept, das perfekt zum Charakter dieser armen, aber begehrten Stadt passt. Firmen und Freelancer mieten sich Schreibtische, für einen Tag, für einige Monate oder gar für Jahre und wissen sich damit als Teil einer nomadisierenden, globalisierten Gemeinschaft, die sich vernetzt, bereichert und dreimal in der Woche bei einem irre interesting Event trifft. "Wir bieten in dieser virtuellen Zeit den virtuellen Arbeitsplatz", so Bauer, "du musst dich nur einstöpseln und fertig."
Inzwischen hat sich in Berlin die größte Start-up-Dichte der Republik gebildet. In einer Stadt, in der es kaum Industrie und kaum Mittelstand gibt, gärt die Hoffnung, selbst ein neues Wirtschaftswunder zu kreieren. Wenn schon kein neues Google, so doch zumindest, bitte, bitte, ein zweites Zalando. Es ist erst ein paar Jahre her, da fotografierten ein paar Nerds ein paar Schuhe in einer Erdgeschosswohnung in der Torstraße. Sie packten Kartons im Hausflur und rauchten Kette im Hinterhof. Heute gilt Zalando als eine der erfolgreichsten Neugründungen der Nachkriegsgeschichte: 3,6 Milliarden Euro Umsatz, allein in Berlin 5700 Mitarbeiter, einer der größten Arbeitgeber der Stadt. "Zalando hätte in Deutschland nirgendwo anders als in Berlin so groß werden können", sagt Robert Gentz, einer der Firmengründer. "Hier gibt es die richtige Infrastruktur, gerade für Tech-Unternehmen."
Business English statt Schwäbisch
Der Erfolg von Zalando lockte weitere Gründer und Talente in die Stadt, die gute Unis, aber kein Stanford oder Berkley hat, die auch nicht wie früher das alte Westberlin mit Fördermillionen nur so um sich wirft. Es war allein der Lockruf der Wildness: Geh nach Berlin, da kannst du es schaffen. Der Hype nährte den Hype.
Im nächsten Jahr, zum zehnten Geburtstag, eröffnet Zalando am Friedrichshainer Spreeufer sein neues Headquarter, ach was, den Zalando-Campus. Direkt gegenüber werden noch einmal 2000 Leute untergebracht – ausgerechnet in Kreuzberg, ausgerechnet auf einer lange umkämpften Brache, wo ein verhasster Investor eine geliebte Strandbar verjagte. "Zalando-Retour" haben empörte Kreuzberger auf das Baustellenschild geklebt und aus Protest Schuhe über den Zaun geworfen.

Es ist wie so oft in dieser Stadt: Das Alte muss dem Neuen weichen, das Verrückte dem Finanzstarken, das Improvisierte dem Etablierten. "Meine Straße, mein Zuhause, mein Block", rappte einst Sido aus dem Märkischen Viertel. Heute sorgt sich Umfragen zufolge jeder zweite Berliner, ob er künftig noch die Miete zahlen kann. Heute fahren Kleinbusse mit verdunkelten Scheiben im Schritttempo durch die Kieze, halten vor Wohnhäusern, spucken asiatische Anzugträger aus, die Fotos machen und Notizen und nach fünf Minuten wieder verschwinden. Wie ein böser Traum. Investoren von Kopenhagen bis Shanghai wollen ihren Anteil am Boom Berlins. Es ist eine Wette auf weiter steigende Preise, eine Wette, die sie nicht verlieren werden. In manchen Ecken der Stadt wütet längst "die Gentrifizierung der Gentrifizierung", wie die "Neue Zürcher Zeitung" schrieb. Heute ist nicht mehr Schwäbisch die Lingua franca, sondern Business English.
"Dieses Haus stand früher in einem anderen Land" verkünden Riesenlettern auf der Fassade eines schwarz gestrichenen Wohnhauses in der Brunnenstraße in Mitte. Man kann diese Worte auf viele Arten lesen: mit Erstaunen, mit Erleichterung oder mit Wehmut. Man könnte sie, leicht abgewandelt, an jede Berliner Fassade schreiben: Dieses Haus stand früher in einer anderen Stadt. Und sie wird morgen wieder eine andere sein. Verdammt, zu werden – nie zu sein.
Dorf mit internationalem Grundgeräusch
Gerd Harry Lybke, genannt "Judy", sitzt im Schaufenster seiner Galerie Eigen + Art, wie immer im Dreiteiler, und blickt hinaus auf die Kleine Auguststraße. "Als ich Anfang der Neunziger herkam, gab es nicht mal Licht auf der Straße", sagt er. Im Gepäck hatte er damals ein paar Werke befreundeter Künstler aus seiner Heimatstadt Leipzig und den kühnen Plan, Kunstgeschichte zu schreiben. Und es geschah: Neo Rauch wurde gefeierter Malerstar, Galerist Lybke führender Händler deutscher Gegenwartskunst und Berlin nach New York größter Galeriestandort der Welt.
Lybke findet, all das, was diese Stadt heute ausmache, habe sie den Zugezogenen zu verdanken. Leuten, die aus London oder Leipzig kamen. Leuten, die "ihre Visionen einfach auf diese herrlich leere Leinwand projizieren konnten". Es gab zwar kein Licht, aber Freiraum und Neugier. Wenn eine Ausstellung eröffnete, kamen 100 Leute – drei Künstler und 97, die dazugehören wollten. Heute kämen 97 Künstler und drei Sammler. So leicht wie damals gehe es heute nicht mehr, aber: "So leicht lässt sich all das, was Berlin ausmacht, auch nicht mehr kaputtmachen", sagt Lybke. Und er blickt hinaus auf die Straße und ruft plötzlich: "Seit Minuten schon kein Auto!" Wo gebe es das sonst auf der Welt? In London oder New York, mitten im Zentrum? Undenkbar! Ein Dorf, das sei Berlin noch immer. Ein Dorf mit internationalem Grundgeräusch.