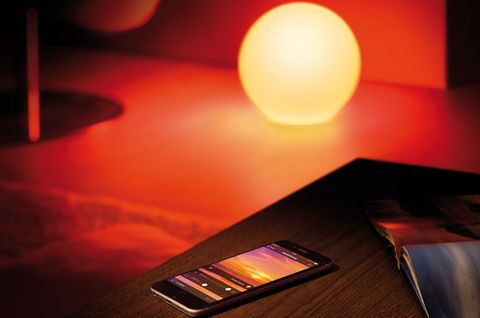Die Glühlampe verschwindet Schritt für Schritt aus den Verkaufsregalen. So will es die EU, die mit ihrer Verordnung von 2009 alle Energiefresser unter den Leuchtmitteln für immer verbannt hat. Natürlich geht damit in Deutschland nicht das Licht aus, denn die Industrie bietet inzwischen eine Fülle von Alternativen. Wer diese geschickt einsetzt, kann im Haushalt pro Jahr über 100 Euro Stromkosten sparen, hat die Stiftung Warentest errechnet. Doch auch Halogen, Energiesparleuchten und LED-Lampen haben ihre Haken. Wir erklären das Pro und Kontra im Detail.
Kompaktstoffleuchten
Kompaktstoffleuchten – im allgemeinen Sprachgebrauch auch Energiesparlampen genannt - sind mit einem elektrisch leitenden Gas gefüllt, ihre Innenseite wiederum ist mit einem Leuchtstoff beschichtet. Alle wissenschaftlichen Tests haben bislang gezeigt: Kompaktstofflampen sind das Leuchtmittel mit der höchsten Energieeffizienz. Sie wandeln etwa 25 Prozent der eingesetzten Energie in Licht um, und im Vergleich zur Glühlampe sparen bis zu 80 Prozent an Strom ein.
Auch in ihrer Lebensdauer ist die Energiesparlampe der Glühbirne um Längen voraus. Nach Angaben des Branchenportals licht.de arbeiten Energiesparlampen je nach Modell zwischen 6000 und 15.000 Stunden. Eine einzige Energiesparlampe kann so laut Stiftung Warentest zehn oder sogar fünfzehn Standardglühlampen ersetzen. Dabei geben die Kompaktstoffleuchten während ihres Lebens nur etwa ein Viertel der CO2-Menge ab, die eine entsprechende Glühbirne erzeugen würde.
Doch das Leuchtmittel hat auch viele Haken: Denn Energiesparlampen leuchten nicht sofort hell, wenn man sie einschaltet, sondern sie brauchen eine gewisse Anlaufzeit. Bei einigen Modellen kann diese Anlaufzeit sogar deutlich mehr als zu zwei Minuten dauern, wie Stiftung Warentest festgestellt hat. Und auch dimmen lässt sich nicht jede Energiesparlampe, was Kritiker bemängeln, da sich durch das Dimmen weiter Strom sparen lässt.
Der wohl gravierendste Nachteil aber ist, dass Energiesparlampen auf Quecksilberbasis leuchten - laut Stiftung Warentest enthalten sie meist zwischen einem halben und vier Milligramm des giftigen Schwermetalls. In der EU erlaubt sind derzeit maximal 5 Milligramm, ab 2012 sinkt diese Grenze auf 3,5 Milligramm. Wegen des Quecksilbers darf die Enegiesparlampe nicht über den regulären Hausmüll entsorgt werden, sondern gehört auf den Sondermüll. Dafür gibt es inzwischen über 6000 Sammelstellen in Kommunen und im Handel. Weil Quecksilber die Gesundheit - vor allem Hirn und Nervensystem - schädigen kann, gelten zudem bei einem Lampenbruch ganz besondere Sicherheitsvorschriften für die Entsorgung. Derzeit bieten nur wenige Hersteller Energiesparlampen mit einem besonderen Splitterschutz an. Jochen Flasbarth, der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) in Dessau, appellierte deshalb unlängst an die Hersteller, mehr bruchgeschützte Energiesparlampen herzustellen, aus denen das Quecksilber erst gar nicht austreten kann.
Verbrauchern rät das UBA dazu, möglichst sorgsam beim Transport, Lagern, Wechseln oder Entsorgen von Energisparlampen zu sein. Geht eine solche Lampe tatsächlich einmal zu Bruch, sollte der Raum - noch vor dem Reinigen - sofort gelüftet werden und alle Bewohner das Zimmer verlassen. Denn die Konzentration an Quecksilber steigt laut Tests des UBA sofort auf ein gefährliches Maß an. Die Untersuchungen zeigten aber auch, dass nach einer Viertelstunde Lüften die Werte wieder auf ein akzeptables Niveau sinken. Weitere detaillierte Sicherheitsvorschriften für die Entsorgung von Energiesparlampen hat die Umwelt-Behörde auf ihrer Internetseite veröffentlicht.
Halogenlampen
Halogenlampen funktionieren ähnlich wie die herkömmliche Glühbirne. Ein Glühfaden aus Wolfram wird durch Strom so stark erhitzt, bis er Licht abgibt. Bei Halogenlampen wird dem Schutzgas um den Glühfaden noch Brom oder Iod zugegeben. Das Licht der Halogenlampe kommt dem der Glühlampe am nächsten – auch äußerlich sehen viele Modelle der herkömmlichen Glühlampe zum Verwechseln ähnlich. Außerdem gibt es sie für alle gängigen Fassungen.
Während die meisten Kompaktstoffleuchten und LED-Lampen noch nicht dimmbar sind, haben Verbraucher hier mit der Halogenlampe keinerlei Nachteile. Im Vergleich zur Energiesparlampe, die meist eine gewisse Anlaufzeit braucht, brennen Halogenlampen sofort nach dem Klick auf den Schalter. Ein weiterer Vorteil: Eine defekte Halogenlampe kann problemlos in den Hausmüll wandern - während Kompaktstoff- und LED-Leuchten gesondert entsorgt werden müssen.
Eine gute Halogenlampe kommt auf etwa 2000 Brennstunden und hält damit etwa doppelt so lange wie eine herkömmliche Glühlampe, im Fachhandel gibt es sie bereits zu Preisen ab 2 bis 3 Euro. So viel sollten Verbraucher aber auch ausgeben, denn der Markt wird - wie übrigens bei den Energiesparlampen und LEDs auch - von billiger Massenware aus Fernost überschwemmt, deren Lichtqualität meist deutlich schlechter und deren Brenndauer geringer ist.
Laut Berechnungen des Herstellers Osram hat der Verbraucher die Anschaffungskosten einer guten Halogenlampe durch die längere Lebensdauer und die Energieeinsparung nach nur drei Monaten wieder raus. Andererseits spart die Halogenlampe im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe aber auch nur 25 bis 30 Prozent Energie ein. Damit schaffen die meisten nur Effizienzklasse C, wodurch sie laut EU-Verordnung ab 2016 der Glühbirne folgen und ebenfalls vom Markt verschwinden müssen.
Ein klarer Nachteil von Halogenlampen ist zudem, dass sie sehr heiß werden. Wegen der Brandgefahr sollten sie insbesondere im Kinderzimmer nur dort eingesetzt werden, wo die Kleinen die Lampen nicht erreichen können.
LED
Die Abkürzung LED steht für Licht emittierende Diode: Es handelt sich um Halbleiter, die leuchten, wenn Strom sie durchfließt. Wie Energiesparlampen benötigen auch LED-Lampen bis zu 80 Prozent weniger Energie, um die entsprechende Helligkeit einer Glühbirne zu erzeugen.
Von der Industrie werden die LED als die Lampen der Zukunft gefeiert. Und auch Stiftung Warentest kürte zwei Exemplare von Osram und Philips zum Testsieger. Im Vergleich zur klassischen Glühlampe sparen LED-Lampen etwa 80 Prozent Energie. Das Manko: Noch sind LED sehr teuer. Zwischen 20 und 30 Euro müssen Verbraucher für Markenware auf den Tisch legen, die teuersten Produkte kosten bis 40 Euro. Eine Anschaffung, die sich auf Dauer aber dort lohnen kann, wo Lampen oft und lange eingeschaltet sind.
Wer eine 40-Watt-Standardglühbirne durch eine LED-Lampe ersetzt, kann in 10.000 Brennstunden etwa 70 Euro Stromkosten sparen, rechnet das UBA vor. Dabei halten manche Modelle nach Angaben der Hersteller noch deutlich länger. Bis zu 25.000 Stunden sollen möglich sein. Wie die Energiesparlampen gelten auch LED-Leuchten als Elektroaltgeräte und sind deshalb ein Fall für den Sondermüll.
Watt zählt nicht mehr
Mit dem Wegfall der Glühbirne wird für Verbraucher der Leuchtmittel-Kauf deutlich schwieriger. Denn bisher schaute der Käufer lediglich auf die Watt-Zahl und wusste, ob er eine helle Leuchte oder eine eher schwache Funzel vor sich hatte. Doch bei den alternativen Leuchten Halogen, LED oder Energiesparlampe führen diese Angaben in die Irre. Der Helligkeit einer 60-Watt-Glühbirne entsprechen nach Angaben des Branchenportals licht.de beispielsweise schon eine gute Energiesparlampe oder eine LED-Lampe mit gerade einmal 11 bis 12 Watt.
Das Problem bei der Suche nach der passenden Lampe ist aber vor allem, dass deren Licht nicht identisch mit dem der Glühbirne ist. Das Licht der Energiesparleuchten beispielsweise empfinden viele Menschen hierzulande als zu kalt, LED erscheint vielen zu grell.
Worauf muss ein Käufer nun also achten? Seit dem vergangenen Jahr müssen die Hersteller sehr genaue Angaben auf die Verpackungen drucken, sie gelten einheitlich sowohl für Halogen-, LED- und Kompaktstoffleuchten. Angegeben werden beispielsweise die Effizienzklasse, die Lebensdauer (in Schaltzyklen), eine Watt-Zahl sowie oft eine Angabe, welcher klassischen Glühlampe dies entspricht. Ebenfalls aufgedruckt ist die Anlaufzeit - also die Zeit, bis die Lampe 60 Prozent ihrer Helligkeit erreicht hat.
Hilfreiche Links
Das Umweltbundesamt informiert auf seiner Internetseite www.umweltbundesamt.de detailliert über die Energiesparlampe und ihre fachgerechte Entsorgung.
Unter www.lichtzeichen.de können Sie sich über Sammelstellen informieren.
Die Brancheninitiative licht.de hat ebenfalls allerlei Informationen rund um das Einrichtungs-Thema Licht zusammengestellt.
Einen aktuellen Energiesparlampen-Test finden Sie bei Stiftung Warentest.
Wichtig ist nun aber auch die in Lumen (lm) gemessene Helligkeit. Dabei gilt: Je höher der Lumenwert, desto heller das Licht. Zur Orientierung: Eine Standardglühlampe mit 60 Watt leuchtet mit etwa 590 bis 650 lm.
Die ebenso bedeutsame Lichtfarbe (Farbtemperatur) wiederum wird in Kelvin (K) angegeben. Je niedriger der Kelvin-Wert, desto wärmer leuchtet die Lampe. 2500 bis 3300 Kelvin stehen für die Lichtfarbe warm-weiß, wobei 2700 Kelvin in etwa dem Licht der nun vom Markt genommenen 60-Watt-Glühlampen entspricht. Einrichtungsexperten raten insbesondere für Wohn- und Schlafräume zu warm-weiß, da kälteres Licht den Schlaf stören kann. Für Büro oder Küche werden "neutralweiß" (3300 bis 5300 Kelvin) oder "tageslichtweiß" (über 5300 Kelvin) empfohlen.
Lampen für den Hausflur oder Keller müssen wiederum schnell hell werden und "schaltfest" sein, wie der Fachmann sagt. Das heißt, sie müssen es locker wegstecken, dass sie oft an- und ausgeknipst werden. Viele Energiesparlampen eignen sich deshalb an solchen Orten nicht, die meisten LED- und Halogenlampen aber schon.
Das Umweltbundesamt empfiehlt außerdem, insbesondere im Kinderzimmer Energiesparlampen nur mit einem zusätzlichen Schutz durch einen Lampenschirm einzusetzen oder gleich zur Halogenlampe zu greifen.