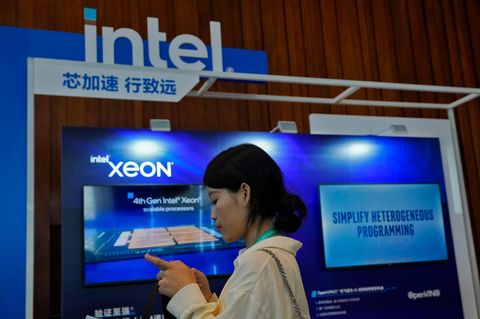Wenn der Elektronikriese Intel wissen will, wie er mit seinen Rechenchips am besten ins Wohnzimmer kommt, ins Auto oder in die nächste Generation von Smartphones, dann wendet er sich an seine Menschenkenner: Ein ganzes Team von Völkerkundlern, Psychologen und anderen Wissenschaftlern schwärmt hinaus in die Welt, um zu beobachten, wie Menschen in allen Erdteilen mit Technik umgehen. In China etwa ist es nicht ungewöhnlich, dem Fernseher eine Strickmütze zu verpassen, um das teure Stück vor Schmutz und Schäden zu beschützen. Im Nahen Osten findet sich in vielen Handys eine Funktion, die anzeigt, wo Mekka liegt - samt Alarm, wenn es Zeit wird, sich im Gebet in diese Himmelsrichtung zu verneigen.
Bisher war die Arbeit der Digital-Alltagsforscher direkt an Produktentwicklung geknüpft. Doch nun hat Intel ein eigenes Labor gegründet, "Interaction and Experience Research", um herauszufinden, was Technik leisten muss, um leicht verständlich zu sein und das tägliche Leben zu bereichern. Denn anders als im PC-Markt, den die Kalifornier seit langem nahezu konkurrenzlos dominieren, müssen sie sich bei Fernsehern, Mobiltelefonen und den mitdenkenden Toastern der Zukunft erst noch bewähren - und Hersteller dieser Geräte überzeugen, Intel-Chips einzubauen, nicht die Produkte anderer Firmen.
Leiterin des neuen Labors ist Genevieve Bell, eine gebürtige Australierin, die von kleinauf das Leben der Anderen kennengelernt hat: Ihre Mutter erforschte als Ethnographin die Gewohnheiten der australischen Aborigines. Im Gespräch mit stern.de erklärt die 43-Jährige, warum Intel-Forscher wochenlang Deutsche, Chinesen oder Inder durch den Alltag begleiten, beobachten und befragen, statt sich auf herkömmliche Marktforschung zu verlassen.
Intel baut Rechenchips, die still und leise in Computern ihren Dienst verrichten. Wozu braucht eine solche Firma ein Labor für Nutzer-Erlebnisse?
Die Welt verändert sich: Intel-Chips finden sich in immer mehr Geräten wieder - in Unterhaltungselektronik etwa, Set-top-Boxen für Fernseher oder auch Mobiltelefonen. Das bedeutet neue Marktchancen für uns, aber wir wissen, dass wir nicht einfach so tun können, als ob jedes dieser Geräte nur darauf wartet, ein PC zu werden. Schon Netbooks sind nicht einfach kleine Laptops, sondern vermitteln ein ganz anderes Nutzer-Erlebnis. Mobiltelefone sind keine kleinen PCs, interaktive Fernseher keine großen PCs, und - Himmel hilf - Autos dürfen nicht zu PCs auf Rädern werden.
Warum nicht?
Schauen Sie sich interaktives Fernsehen an. Anfangs ist Intel daran gegangen wie an jedes andere Produkt auch; wir haben uns gefragt: "Wie können wir aus dem Fernseher einen Computer machen?" Mir schien das der falsche Ansatz. Meine Kollegen und ich haben ein Jahr lang untersucht, was der Fernseher für Menschen rund um die Welt bedeutet. Dabei ist klar geworden: Die Leute lieben, lieben, lieben ihren Fernseher. Einer der Gründe ist das soziale Element; Fernsehen kann man gemeinsam mit Freunden und Familie genießen. Ein anderer Grund ist die einfache Bedienung: Man schaltet den Fernseher an, und hinter diesem einem Knopf verbirgt sich eine Fülle von Geschichten. Obendrein ist das TV-Gerät ein Tausendsassa: im einen Moment eine Filmleinwand, im nächsten der Bildschirm für die Spielekonsole, dann wieder ein Babysittter für die Kleinen.
Was haben Sie daraus gelernt?
Auch Internetfernsehen muss ganz einfach, wandlungsfähig und ein soziales Erlebnis sein. Wenn wir die Online-Welt ins Wohnzimmer bringen, muss das Komplizierte draußen bleiben. Wer Fußball schaut oder mit seinem Liebsten einen romantischen Film sieht, möchte nicht hören, dass noch viele andere Sendungen auf der Festplatte bereit liegen, dass erfolgreich eine andere Sendung aufgenommen wurde oder dass neue Treiber erhältlich sind. Es möchte auch niemand, dass das Gerät in der guten Stube anfängt zu brüllen wie ein startender Kampfjet, weil plötzlich der Lüfter anspringt.
Auf solche Dinge kommen die Entwickler nicht von allein?
Manchmal braucht man den Blick von außen, um daran erinnert zu werden, was die Welt ewartet. Das ist unsere Aufgabe: herauszufinden, was Menschen an den Geräten lieben, mit denen sie sich umgeben, um diese Erkenntnisse an die Ingenieure weiterzugeben. Was begeistert Menschen an E-Readern, mit denen sie digitale Bücher lesen; an den Autos, die sie fahren; ja selbst an der Wohnungselektronik, der Heizung, dem Thermostaten, der Beleuchtung? Denn das sind alles Dinge, die schon jetzt oder in naher Zukunft mit dem Internet verbunden werden, und wenn wir nicht aufpassen, bringen wir das Komplizierte, das Ingenieure lieben, gleich mit.
Warum ist das Nutzer-Erlebnis so wichtig?
Es reicht nicht, nur Produkteigenschaften anzupreisen: "Hiermit können Sie besser nach der Wettervorhersage schauen." Fein, aber wozu soll das gut sein? Wir müssen herausfinden, welche Rolle die Geräte jeweils im Leben der Menschen spielen, um die Technik schlauer zu machen und das Erlebnis zu verbessern, statt womöglich das Gegenteil zu erreichen.
Wie gehen Sie vor?
Wir wenden eine Reihe von Forschungsmethoden an, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, Menschen zu beobachten, sich mit ihnen zu unterhalten, ihnen zuzuhören, ganz offen zu sein. Man kann sie nicht in ein Labor stecken und Experimente machen. Wir müssen dort sein, wo die Menschen leben, bei ihnen zu Hause und überall sonst, wo sie sich aufhalten. Fragebogen funktionieren nicht. Oft sagen Leute das Eine, verhalten sich aber ganz anders. Und nur wenn man Menschen durch den Alltag begleitet, findet man auch Dinge heraus, über die niemand redet, weil sie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wichtig erscheinen - etwa, dass im Wohnzimmer alle Möbel um den Fernseher herum aufgestellt sind.
Wie reagieren die Entwickler, wenn Sie mit Ihren Erkenntnissen zurückkommen?
Früher waren sie überrascht, und oft gab es Vorbehalte. Aber nach zwölf Jahren Zusammenarbeit haben wir alle gelernt und uns aufeinander zu bewegt. Mir ist klar geworden, dass es nicht genügt, mit Anekdoten und Beobachtungen zurückzukommen - ich versuche stärker, gleich zu verstehen, was das alles für ein Produkt bedeuten könnte. Und die Ingenieure sind viel offener geworden, unsere Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bisweilen rennen sie uns regelrecht die Türen ein. Ich hätte nie gedacht, dass uns das in einem Unternehmen, das so von Technikern bestimmt wird, je passieren würde.
Lesen Sie dazu auch bei unserem Partner in der Schweiz, 20 Minuten Online, das "Interview mit Steven Bathiche - daran arbeitet Microsoft Research"