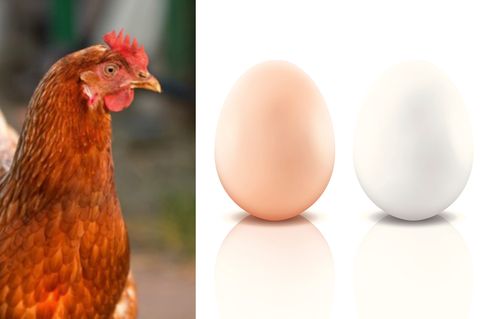"Ich wollt', ich wär' ein Huhn, Ich hätt' nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei", sangen einst die Comedian Harmonists und zeichneten damit ein ganz und gar stressfreies Bild vom Leben des Huhns. Die Realität in der Eierindustrie aber sieht oftmals ganz anders aus. Noch immer fristen Millionen Hühner ein Dasein in engen Käfigen, noch immer kursieren Bilder von kranken und gerupften Hennen.
Eine bessere Lobby haben da die Bruderhahn-Eier. Die Betriebe gelten als nachhaltig und tierfreundlich, denn sie verzichten darauf, die männlichen Küken zu töten. Dafür bezahlen die Verbraucher ein bisschen Mehr. Aber ausgerechnet die Bruderhahnzucht wurde nun von der Verbraucherorganisation "foodwatch" heftig kritisiert.
Bruderhahn-Eier: "Aufzucht ist Augenwischerei"
Der Appetit der Deutschen auf Eier ist groß. Im Schnitt isst jeder im Jahr 236, so die Zahlen des Deutschen Bauernverbands. Das heißt: die Hühner müssen liefern. Die Aufzucht männlicher Küken rechnet sich für die Betriebe nicht. Millionen sogenannter Eintagsküken werden daher jedes Jahr direkt nach dem Schlüpfen getötet - zumindest noch. Ende des Jahres soll damit Schluss sein. Damit ist Deutschland das erste Land weltweit, welches das Kükentöten per Gesetz verbietet. Betriebe, die schon jetzt Bruderhähne zur Fleischerzeugung aufziehen, subventionieren das mit einem Aufpreis auf die Eier. Ein Fortschritt in Sachen Tierschutz möchte man meinen. Bei "foodwatch" aber sieht man das anders.
"Die Aufzucht der Bruderhähne ist Augenwischerei – sie ändert nichts am Leid der hochgezüchteten Legehennen, sie ist weder tierfreundlich noch nachhaltig", sagte Matthias Wolfschmidt, Veterinärmediziner und Strategiedirektor bei der Organisation. "Es ist höchste Zeit, dass die tierquälerische Hochleistungszucht gesetzlich verboten und durch die Zucht von robusteren und gesünderen Hühnerrassen ersetzt wird."
Mehr Tierschutz
In Deutschland werden zwischen 40 und 50 Millionen Hühner für die Eierproduktion gehalten. Viele Millionen Legehennen litten – weil sie auf das Legen von maximal vielen Eiern gezüchtet würden – unter teils schwerwiegenden Krankheiten, wie Knochenbrüchen und Brustbeinschäden, so die Verbraucherorganisation. Diese genetische Veranlagung führe dazu, dass auch die Männchen nur wenig Fleisch ansetzten, aber gleichzeitig sehr viel hochwertiges Futter benötigten. Ihre Mast gehe somit mit einem hohen Ressourcenverbrauch einher. Zudem entspreche das Fleisch von Bruderhähnen lediglich der Qualität eines Suppenhuhns. Und weiter: In der landwirtschaftlichen Praxis ließen sich die Mehrkosten für die Bruderhahnmast mit einer bedarfsgerechten Fütterung kaum durch die Quersubventionen über die Eier decken.

In der vergangenen Woche erst rief Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Verbraucher dazu auf, beim Ostereinkauf im Sinne des Tierwohls zu Eiern aus Haltung ohne Kükentöten zu greifen – also auch zu Bruderhahn-Eiern. Sie tische damit den Menschen, so "foodwatch", ein Märchen auf. Diese könnten "das tierquälerische System nicht mit dem Kauf vermeintlich ethisch korrekter Ostereier reparieren". Anstelle die Verantwortung abzuschieben, solle die Regierung ihre Arbeit machen "und das im Grundgesetz verankerte Staatsziel Tierschutz umsetzen".
Hin zum Zweinutzungshuhn
In der gesamten Europäischen Union dürfen Hühner auf vier verschiedene Arten gehalten werden: ökologische Erzeugung, Freilandhaltung, Bodenhaltung und ausgestaltete Käfige. Letztere werden ab 2025 in Deutschland auch Geschichte sein. Legebatterien, also konventionelle Käfige, sind ohnehin in der gesamten EU verboten. Der Großteil der Eier im Handel stammt aus Bodenhaltung (etwa 62 Prozent). Dort sind sechs Hennen pro Quadratmeter zugelassen. In der Freilandhaltung (19 Prozent) dürfen sie zusätzlich auch an die frische Luft. Eier aus ökologischer Erzeugung machen etwa 11 Prozent aus. Weniger als zehn Prozent der Eier stammen aus Käfighaltung. Informationen zur Haltungsform und der Herkunft bekommen Verbraucher über den Code, dem jedes Ei inzwischen aufgedruckt wird.
Anstelle der Bruderhahnaufzucht fordert die Verbraucherorganisation einen Umstieg auf sogenannte Zweinutzungshühner. Diese sind nicht nur robuster und weniger krankheitsanfällig, sie eignen sich außerdem sowohl für die Eier- als auch zur Fleischproduktion und könnten wirtschaftlich gehalten werden. Mit bis zu 250 gelegten Eiern im Jahr legen diese im Schnitt zwischen 50 und 70 weniger als eine Hochleistungshenne. Die Fleischqualität der Hähne sei deutlich besser als die eines Bruderhahns.
Quellen: Foodwatch, Deutscher Bauernverband, Statista